|
... in Myanmar (Birma)
ပြည်ထောင်စု
သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
Glossar
Diese Seite wird
seit dem 09.10.2016 nicht mehr aktualisiert ...
Sollen wir oder sollten wir besser nicht???
Seekirchener Kreise, die in den Neunzigern das Land bereisten,
haben uns bereits in Patagonien überzeugend vorgeschwärmt, dass Birma „…
das Land ist für Euch und Eure Art des Reisens!“ Damit war der Floh
im Ohr aufgeschreckt.
Die,
nun ja, nicht ersten
„demokratischen Wahlen“ im Lande und
die für uns unwägbaren innenpolitischen Folgen lenkten unseren Weg
zunächst nach Laos und Kambodscha – im vergangenen Jahr. All die
Menschen, die wir während unserer Reise dort getroffen haben und
die „gerade aus Myanmar“ kamen oder „Jahre zuvor vor
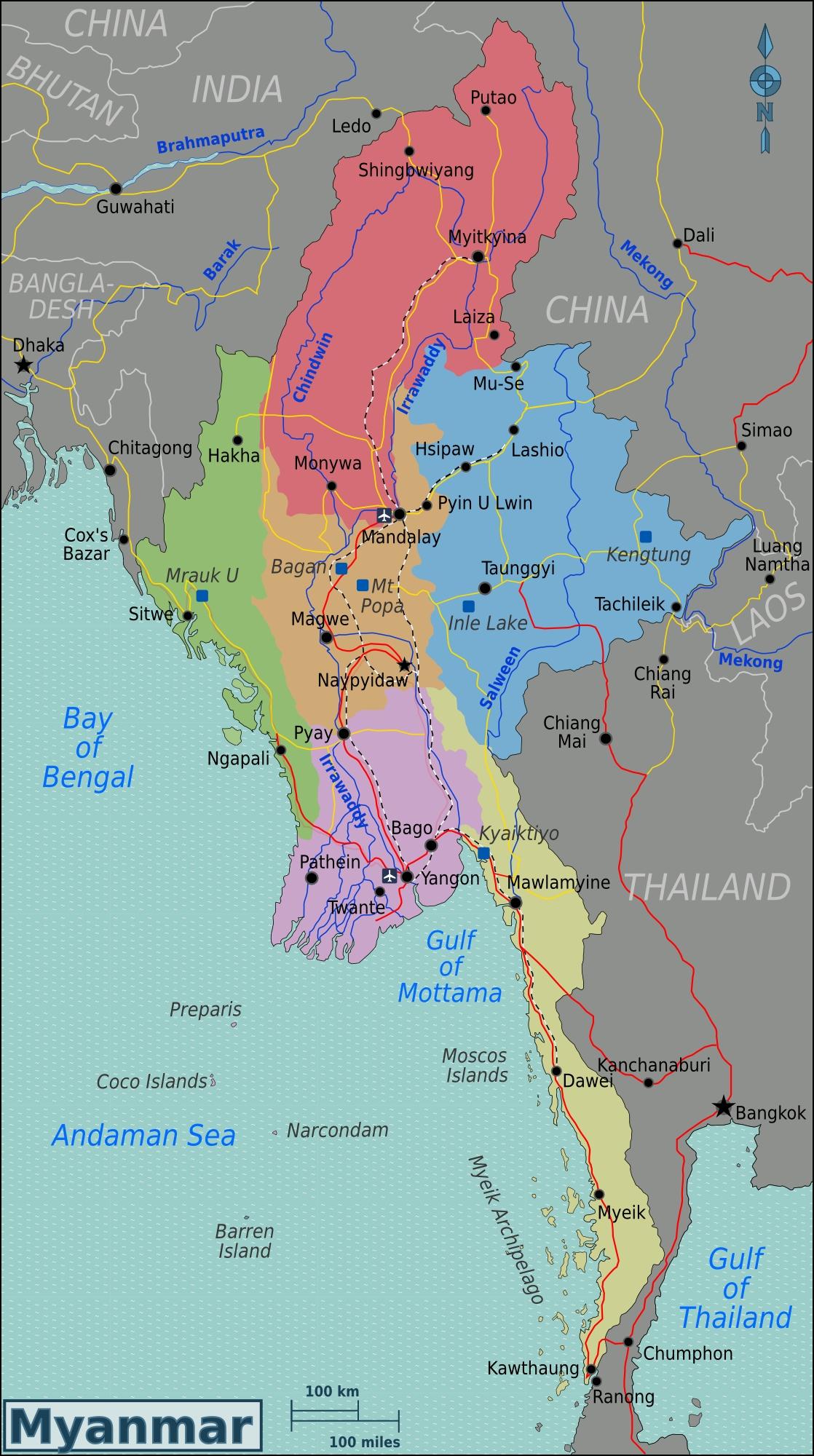 Ort gewesen waren“, zeigten sich begeistert und rieten uns, so bald wie
möglich dort hin zu fahren, bevor „es wird wie Vietnam“ …
Ort gewesen waren“, zeigten sich begeistert und rieten uns, so bald wie
möglich dort hin zu fahren, bevor „es wird wie Vietnam“ …
Grundsätzliches gab es zu
diesem Zeitpunkt für uns nicht mehr zu entscheiden: Die im
Lonely Planet (und nicht nur dort)
formulierten Überlegungen
hatten wir bereits durch dekliniert, inhaltlich übereinstimmende
Aussagen von Kubanern, Vietnamesen, Libyern und von all denen, die zwar
nicht in
forma, doch de facto in totalitären oder
in Systemen leben, die ihr Verhältnis zu den Menschenrechten nach
Belieben ökonomischen oder "Sicherheits"interessen unterordnen - Wem
untersteht noch mal
Guantanamo? - im Ohr: „If you don’t
come to our country, you cannot help us ...
Tell your people what you see, how we live and how we do!“
Werden
wir, versprochen …
…
auch wenn uns das nicht allzu einfach gemacht werden dürfte – zeitnahe
Informationen sind ob des eher eingeschränkten Internetzugangs nicht
unbedingt gewährleistet und in wie fern das innenpolitische Klima
bereits öffentlich kontrollierte Offenheit jenseits
zeitgenössischer politischer Kosmetik
hinter vorgehaltener Hand zulässt, warten wir mal ab. Ab Anfang Dezember
erfahrt Ihr mehr, hoffentlich …
Werft zur
Einstimmung schon mal einen Blick ins Archiv der
Süddeutschen und
- fast zwanzig Jahre älter - auf eine
SPIEGELreportage von Tiziano Terzani
...
.jpg) Wir
wollen am letzten Tag im November ohne witterungsbedingte oder sonstige
Widrigkeiten stressarm nach Bangkok gelangen, um nach einer
Übernachtung in Flughafennähe am 02.12. in Yangon den Einreisestempel
einzufangen, dem Jetlag ein Schnippchen zu schlagen und uns nicht all zu
sehr daneben zu benehmen. Und wir schaffen das, wir sind ja noch jung
... Wir
wollen am letzten Tag im November ohne witterungsbedingte oder sonstige
Widrigkeiten stressarm nach Bangkok gelangen, um nach einer
Übernachtung in Flughafennähe am 02.12. in Yangon den Einreisestempel
einzufangen, dem Jetlag ein Schnippchen zu schlagen und uns nicht all zu
sehr daneben zu benehmen. Und wir schaffen das, wir sind ja noch jung
...
(Aktuelles aus dem
World Fact Book).jpg)
(Was
das AA zu unserer Reise meint ...)
(... und die
Reisemedizin empfiehlt)
(tourism
watch)
(bewaffnete
Konflikte im Land)
(im Rück-SPIEGEL: Was
sich wie
verändert ...)
(amnesty
international zur Situation ...)
(... und
International Crisis Group)
(Reporter
ohne Grenzen)
("Lass
uns die Reise beginnen")
(wikipedia zu
Myanmar)
(NZZ
Reportage)
(tourism
watch Juni 2015)
(Literatur
zum Einlesen)
War leider nix ...
mit Anfang Dezember:
Zwar äußern sich die Einheimischen, mit denen wir intensiver ins
Gespräch kommen, auch in der Öffentlichkeit durchaus kritisch über Gott,
die Welt und vor allem ihre alten wie neuen "Great Leaders", doch hält
die digitale Kommunikationstechnik nicht ganz Schritt. E-Mails ohne
großen Anhang lassen sich abrufen und verschicken, ohne dass Willi die
Barthaare deutlich länger werden. Heruntergebrochene Bilder über picasa
hoch zu laden oder gar auf den Server zu gelangen, erfordern hingegen ein
Quantum an Geduld, das er vermutlich erst als Asche aufbringen dürfte.
Wie mit dem Lieben Gott
hat er halt auch mit Buddhismus wenig am Hut ...
(unsere Reiseroute vom 2. bis 28. Dezember -
erste Etappe)
Yangon ...
hat mit uns ein ähnliches Problem wie seinerzeit Brandenburg a. d. Havel: Es
müssen Jahrzehnte vergehen, bevor sich der Ort vom Stadtbild her einen
Platz in
.jpg) unserem
Herzen erobern kann. Dem Morbiden wohnt eben nicht per se der Charme
inne, welcher beim Anblick bröckelnder Fassaden, Schimmel befallenen
Mauerwerks, schiefer Wände oder architektonischer Ensembles, die mal
bessere Zeiten gesehen haben, venezianische Beglückung oder, wie beim
Schlendern durch die Altstadt Havannas, hoffnungsschwangere Seufzer
auslöst. unserem
Herzen erobern kann. Dem Morbiden wohnt eben nicht per se der Charme
inne, welcher beim Anblick bröckelnder Fassaden, Schimmel befallenen
Mauerwerks, schiefer Wände oder architektonischer Ensembles, die mal
bessere Zeiten gesehen haben, venezianische Beglückung oder, wie beim
Schlendern durch die Altstadt Havannas, hoffnungsschwangere Seufzer
auslöst.
Ob
leere Fensterhöhlen, morsches Dachgebälk oder abgeranzte Aufgänge dem.jpg) über Jahre hinweg surreal existierenden realen Sozialismus oder der
„Un-splendid Isolation“ des Militärregimes anzulasten sind, sei dahin
gestellt. Im Laufe der
Zeit hat chinesisches Kapital nach dem Coca Cola Deal – alles andere
als Ping Pong mäßig (es gab und gibt Matchbälle nur für den großen
Nachbarn) – Baulücken geschlossen, fünfstöckige Wohn- und
Geschäftshäuser mit verspiegelten Glasfronten in den Straßenzügen
erstellt und den Handel (gerade auch mit Waren, die dem Boykott
unterliegen) fest in die Hand genommen.
über Jahre hinweg surreal existierenden realen Sozialismus oder der
„Un-splendid Isolation“ des Militärregimes anzulasten sind, sei dahin
gestellt. Im Laufe der
Zeit hat chinesisches Kapital nach dem Coca Cola Deal – alles andere
als Ping Pong mäßig (es gab und gibt Matchbälle nur für den großen
Nachbarn) – Baulücken geschlossen, fünfstöckige Wohn- und
Geschäftshäuser mit verspiegelten Glasfronten in den Straßenzügen
erstellt und den Handel (gerade auch mit Waren, die dem Boykott
unterliegen) fest in die Hand genommen.
Die
Beschaffenheit der Gehwege wertet Spaziergänge zu Geländetouren auf, der
Fahrbahnbelag erinnert an die Phase, da unsereiner den "Aufschwung Ost" vornehmlich über die Abzüge des Solizuschlags wahrgenommen hat.
Weil die Geschäftsräume klein und die Werkstätten eng sind, spielt sich
ein
.jpg) großer
Teil des Berufslebens wie des Gewerbes auf öffentlichem Straßenland ab:
„Damespieler“ zocken auf dem Gehweg neben einem Grobmechaniker, der
Zylinderkopfdichtungen nach Schablone ausschneidet, und den Jungs, die
alle möglichen gebrauchten Gewindestangen im Petroleumbad reinigen.
Private öffentliche Telefonzellen bestehen aus Kunststoffsitzmöbeln,
welche um einen winzigen Tisch gruppiert stehen, der vier, fünf
klassische Telefone (Schnurverbindung) trägt. Wer hier fernmündlich
kommuniziert, erzählt alles öffentlich – und erfährt vieles … großer
Teil des Berufslebens wie des Gewerbes auf öffentlichem Straßenland ab:
„Damespieler“ zocken auf dem Gehweg neben einem Grobmechaniker, der
Zylinderkopfdichtungen nach Schablone ausschneidet, und den Jungs, die
alle möglichen gebrauchten Gewindestangen im Petroleumbad reinigen.
Private öffentliche Telefonzellen bestehen aus Kunststoffsitzmöbeln,
welche um einen winzigen Tisch gruppiert stehen, der vier, fünf
klassische Telefone (Schnurverbindung) trägt. Wer hier fernmündlich
kommuniziert, erzählt alles öffentlich – und erfährt vieles …
Verhungern oder Verdursten sind in unserem Viertel ob der zahlreichen
privaten.jpg) Essensstände (Muttern bereitet vor aller Augen zu – und kocht
selbst, wie bei Muttern eben) schlichtweg unmöglich. Ein spilleriges
Männchen, das besser sein eigener Kunde wäre, stellt die richtige
Mischung Trockenmilch her und der Dealer für
Betelnüsse sorgt für die
nötige Dosis in der gewünschten Geschmacksrichtung. Ihr ahnt, die
Menschen hier sind bereits tief in unserem Herzen angekommen ...
Essensstände (Muttern bereitet vor aller Augen zu – und kocht
selbst, wie bei Muttern eben) schlichtweg unmöglich. Ein spilleriges
Männchen, das besser sein eigener Kunde wäre, stellt die richtige
Mischung Trockenmilch her und der Dealer für
Betelnüsse sorgt für die
nötige Dosis in der gewünschten Geschmacksrichtung. Ihr ahnt, die
Menschen hier sind bereits tief in unserem Herzen angekommen ...
Sie nehmen uns als Fremde wahr, nicht mehr und
nicht weniger. Einige, des
Englischen mächtig, knüpfen freundlich ein
Gespräch an – aus menschlichem
.jpg) Interesse,
nicht des business wegen (was sollen wir schon mit Gewindestangen …).
Aufdringlich sind weder die Ansichtskartenverkäufe-rinnen vor der
Sule Pagode
noch diejenigen, welche Blumengebinde für den Buddha an die Frau
bringen wollen; nicht einmal die illegalen Geldwechsler nerven
ernsthaft. Interesse,
nicht des business wegen (was sollen wir schon mit Gewindestangen …).
Aufdringlich sind weder die Ansichtskartenverkäufe-rinnen vor der
Sule Pagode
noch diejenigen, welche Blumengebinde für den Buddha an die Frau
bringen wollen; nicht einmal die illegalen Geldwechsler nerven
ernsthaft.
Situationen, in denen unsere Hände zum „Geldfach“ in der Hose zucken
oder in denen wir uns Uniformen herbei wünschten, bleiben uns
bis dato erspart – und daran muss sich auch nichts wirklich ändern. Übrigens: In
der Stadt nehmen wir so gut wie kein Militär und nur sehr wenige
Polizeikräfte wahr. Private Wachdienste hingegen sind nicht nur vor
Banken gefragt ...
(weitere
Infos zu
Yangon)
(Fotos zum
ersten Eindruck
...)
(... und
bei der
Arbeit)
Auf
der Ringbahn …
einmal um die Hauptstadt – der Menschen, nicht der Landschaft wegen.
Hier ist allein der Weg das Ziel!
Vom
aus der Distanz arg pompös wirkenden Hauptbahnhof, der bereits vor dem.jpg) Betreten auf die Größe seiner maroden Bausubstanz zusammen schrumpft, fährt der
„Circle Train“ einmal mit der Kirche ums Dorf. Hilfreiche, des
Englischen nicht mächtige Finger weisen uns den Weg zu „plattform 75“,
wo ein netter Fahrkartenverkäufer uns an der Nasenspitze ansieht, was
wir Langnasen möchten. Die Fahrkarte, von Hand gemalt, wäre in Preußen
nicht akkurater ausgestellt worden. Unentgeltlich gibt’s den
gestikulierten Hinweis auf den richtigen Zug (wir sind auch in diesem Land
schlichtweg Analphabeten) und das „angemessene Abteil“ zum Einsteigen.
Betreten auf die Größe seiner maroden Bausubstanz zusammen schrumpft, fährt der
„Circle Train“ einmal mit der Kirche ums Dorf. Hilfreiche, des
Englischen nicht mächtige Finger weisen uns den Weg zu „plattform 75“,
wo ein netter Fahrkartenverkäufer uns an der Nasenspitze ansieht, was
wir Langnasen möchten. Die Fahrkarte, von Hand gemalt, wäre in Preußen
nicht akkurater ausgestellt worden. Unentgeltlich gibt’s den
gestikulierten Hinweis auf den richtigen Zug (wir sind auch in diesem Land
schlichtweg Analphabeten) und das „angemessene Abteil“ zum Einsteigen.
Die
Rüttelbank im letzten Waggon ist dem Zugabfertiger vorbehalten – und uns
– und wird, kaum dass uns ein privilegierter Einheimischer seinen
Fensterplatz angeboten hat, mit einer Schnur deutlich wahrnehmbar als
Dienstabteil abgegrenzt.
.jpg) Mit
uns in der Holzklasse sitzen all die Einheimischen, welche sich kein Taxi
und auch keinen Bus in die entlegene Peripherie der Großstadt leisten
können / wollen – oder die Großvolumiges zu transportieren haben, das
einen Container erforderte. Gemeint sind nicht die Gemüsekörbe oder
Polentaschen, die auf Köpfen balanciert in den Wagen wandern. In
riesigen Säcken finden Kubikmeter an PET-Flaschen den Weg in den
Mittelgang, um, wo immer auch sortiert, wieder dem
Getränke-vermarktungskreislauf zugeführt zu werden. Außer lebenden
Tieren in sichtbarer Größe wird alles befördert. Mit
uns in der Holzklasse sitzen all die Einheimischen, welche sich kein Taxi
und auch keinen Bus in die entlegene Peripherie der Großstadt leisten
können / wollen – oder die Großvolumiges zu transportieren haben, das
einen Container erforderte. Gemeint sind nicht die Gemüsekörbe oder
Polentaschen, die auf Köpfen balanciert in den Wagen wandern. In
riesigen Säcken finden Kubikmeter an PET-Flaschen den Weg in den
Mittelgang, um, wo immer auch sortiert, wieder dem
Getränke-vermarktungskreislauf zugeführt zu werden. Außer lebenden
Tieren in sichtbarer Größe wird alles befördert.
Auf
der langen Bank sitzen Menschen aller Alters-, Gewichts- und sonstiger
Klassen. Laptoptaschen sind zuhauf, Guccitäschchen eher weniger
vertreten. Über den jeweiligen Inhalt möchten wir nicht weiter
spekulieren …
Damit niemand "on the railroad" darben muss, pendeln Versorger aller
Couleur durch.jpg) den Zug. Betelnussverkäufer bereiten ihre Droge je nach gewünschter
Geschmacksrichtung zu – dass die Rotze immer und überall rote Flecken
hinterlässt, was soll’s … Auch Handfestes wie frische Eier, Avocados,
selbst gemachtes Eis am Stiel, abgepackte Chips, selbst Gebackenes,
Nüsse, Obst, Trinkwasser etc. werden gerne gereicht.
den Zug. Betelnussverkäufer bereiten ihre Droge je nach gewünschter
Geschmacksrichtung zu – dass die Rotze immer und überall rote Flecken
hinterlässt, was soll’s … Auch Handfestes wie frische Eier, Avocados,
selbst gemachtes Eis am Stiel, abgepackte Chips, selbst Gebackenes,
Nüsse, Obst, Trinkwasser etc. werden gerne gereicht.
Ausgesprochen angenehm wirken die Umgangsformen: Nicht nur für den Mönch
(zu gegebener Zeit später mehr über ihn und seine KollegInnen ...), auch für die ältere, gebückt gehende Frau
oder den schwer beladenen jüngeren Mann rückt mensch zusammen. Jung und
Alt wird beim Ein- wie beim Aussteigen die Hand gereicht. Und ob der
kurzen Haltezeiten hilft jeder jedem – ob schwer, ob sperrig, ob
zerbrechlich, mitgeführtes Gepäck wird aus dem Wagen gereicht oder
aufgenommen. Hier hat nix Wichtiges eine Chance liegen zu bleiben!
Und
wieder am Hauptbahnhof angekommen achtet nicht nur der Zugbegleiter darauf,
dass wir aussteigen – und auf dem Bahnsteig in die richtige Richtung
laufen …
(Fotos zur
Ringbahn)
Statt Abenteuer …
auf
dem Schwarzmarkt risikoarmer Event auf der Bank: Bereits vor dem
Gebäude mustern uns drei uniformierte, bewaffnete Cerberusse. Der mit den
meisten Pickeln auf der Schulter geleitet uns zu einer Sitzgruppe und
gibt uns zu verstehen, dass „bank closed“ ist – dabei wimmelt es von
Kunden im Schalterraum. Das freundliche Lächeln auf dem Antlitz gleich
zweier holder Maiden braucht schon keiner Worte mehr, um aufzuklären:
Die Wechselstube öffnet erst später. Die beiden vermitteln uns das
Gefühl, dass sich Bank in einer halben Stunde auf uns ganz persönlich -
und weniger auf unsere Devisen - freut.
.jpg) Wir
begeben uns also zunächst in die Obhut eines ernst zu nehmenden
Morgen„kaffes“ ins "Tokyo Donut" – hier schafft Willi es auch ins
Internet, doch das ist ein anderes Drama ... Wir
begeben uns also zunächst in die Obhut eines ernst zu nehmenden
Morgen„kaffes“ ins "Tokyo Donut" – hier schafft Willi es auch ins
Internet, doch das ist ein anderes Drama ...
Die Bankhüter zeigen sich sichtlich bemüht, uns die Rückkehr zum
"Change" so angenehm wie möglich zu gestalten. Einer geleitet uns zu den Geldwechslern in der ersten Etage: Warteraum wie in der AOK für privat
Versicherte, doch mit nobler Auslegware und gepolsterten Sitzreihen
ausgestattet, acht unbesetzte Schalter (siehe Deutsche Post). Einer, der
„Foreign Exchange Desk“, wartet mit drei hübschen, adrett kostümierten
jungen Damen auf, neben denen zwei uniformierte Gouvernanten
drachenartig alle Schätze dieser Welt zu hüten scheinen. In Dreilinden wären
letztere ohne weiteres als Sächsinnen durchgegangen, gäbe es da nicht
die uni sono freundliche Begrüßung und die wohl formulierte Frage, wie frau uns denn helfen
(sic!)
könne.
Barbara blättert 500 € in großen Scheinen auf den Tresen, erhält gegen
ihren.jpg) Pass einen gestempelten Vordruck, auf dem sie sich erklären darf und
sieht, wie die drei Hübschen ihr beim Schreiben zuschauen, während die
Drachinnen Schein für Schein genauestens inspizieren. Die ihnen
vorliegende Musterkopie
in schwarzweiß eignet sich eher nicht für Farbabgleichungen. Dafür
wandern Fingerkuppen über die Ränder und Ecken der Hunnies, suchen
Risse oder versteckte Falten und geben sich erst zufrieden, als die
Karatzahl jedes einzelnen Exemplars der Deutschen Bundesbank exakt
bestimmt ist.
Pass einen gestempelten Vordruck, auf dem sie sich erklären darf und
sieht, wie die drei Hübschen ihr beim Schreiben zuschauen, während die
Drachinnen Schein für Schein genauestens inspizieren. Die ihnen
vorliegende Musterkopie
in schwarzweiß eignet sich eher nicht für Farbabgleichungen. Dafür
wandern Fingerkuppen über die Ränder und Ecken der Hunnies, suchen
Risse oder versteckte Falten und geben sich erst zufrieden, als die
Karatzahl jedes einzelnen Exemplars der Deutschen Bundesbank exakt
bestimmt ist.
Nun
darf Barbara sich setzen – ihr Pass ist an der Reihe. Alle fünf
(Unter-)Beschäftigte blättern sich von Stempelabdruck zu Stempelabdruck und
sobald ihnen das weltweite Umherschweifen der Besitzerin geläufig genug ist,
erscheint ein kräftiger Mann mit einem knapp Ziegelstein großen Packen
Scheine:
.jpg) Die
werden ihr freundlich lächelnd überreicht – mit Plastiktüte und dem
Hinweis, der Geldzählmaschine die Mühe zu überlassen, die
sie gerade auf sich nehmen wollte. Eine der entzückenden
„Drachenbeschwörerinnen“, Tschep, begleitet uns in den Schalterraum,
auf dessen Tresen und Fußboden jede Menge „Ziegelsteine“ auf Paletten
gestapelt vor den Countern lagern. Hier warten Kubikmeter an
Kyatscheinen aufs Gezähltwerden. Barbaras Stapel nimmt sich dagegen
mehr als popelig aus ... Die
werden ihr freundlich lächelnd überreicht – mit Plastiktüte und dem
Hinweis, der Geldzählmaschine die Mühe zu überlassen, die
sie gerade auf sich nehmen wollte. Eine der entzückenden
„Drachenbeschwörerinnen“, Tschep, begleitet uns in den Schalterraum,
auf dessen Tresen und Fußboden jede Menge „Ziegelsteine“ auf Paletten
gestapelt vor den Countern lagern. Hier warten Kubikmeter an
Kyatscheinen aufs Gezähltwerden. Barbaras Stapel nimmt sich dagegen
mehr als popelig aus ...
Dennoch füttert ein Uniformierter damit die Maschine – und die irrt sich
nicht. Noch bevor das Papier in die Tüte wandert, gestattet mir Tschep
ein paar Aufnahmen von den offiziell laufenden Transaktionen – und
äußert mit hoffnungsvoll verklärtem Blick, dass dereinst Geldgeschäfte
auch in Myanmar zumindest via Plastik zu bewerkstelligen sind - die
Reinkarnation der Scheine in veränderter Hülle. Sie wünscht uns eine
wundervolle Reise und freut sich auf unseren nächsten Besuch – auch
persönlich. Wir werden ihn zu schätzen wissen, ohne das Zählen zu
verlernen …
(pecunia
non olet)
(aktueller
Umtasuchkurs)
With Music on the Bus …
rollen wir gemächlich vom Terminal – nach einer gut vierzigminütigen
Fahrt im Taxi, bei der wir einmal mehr erfahren dürfen, warum wir
Westler bei Dunkelheit aufs Autofahren in asiatischen Städten verzichten
sollen: Die Straßen erinnern an manche Verkehrswege der neuen Länder,
als letztere noch ganz neu waren.
Außerdem bewegen sich gegen 5:00 Uhr in der Früh bereits Himmel und
Menschen recht unorthodox auf wichtigen Straßen. Und über den Umfang der
Beleuchtung ihrer Fahrzeuge entscheiden die jeweiligen Chauffeure selbst
…
Der
unsere bewegt nicht zum ersten Mal Touristen zum Busbahnhof am
Stadtrand und weiß, dass die Kraft in der Ruhe liegt und der Weg allein
nicht immer das Ziel ist.
Dort geht es zu wie in einem Ameisenhaufen, in dem wir ohne kundige
Unterstützung den Standort unseres Liners wohl erst nach dessen
Abfahrt gefunden hätten, obwohl wir mehr als preußisch pünktlich zur
Stelle sind.
Um das Wohl der Fahrgäste bemüht sich bereits zu
früher Stunde eine Armada an fliegenden wie sitzenden Händlern, welche
einem den Tagesbeginn mit Speisen und Getränken aller Art zu versüßen
suchen. Mit DIN A 4 großen Farbkopien verehrter Lamas, des Staubes
wegen laminiert, in der einen und doppelt so großen Porträts von
Aung San Sun Kyi
und
ihrem Vater in der anderen, drängt sich die Bilderabteilung zwischen
den Fahrzeugen und drückt ihre Sympathie für die „Neue Politik“ aus.
(Aktuelles zur
"Lady", ...)
(... ihre Dankesrede
in Oslo 2012)
(... und die
Haltung der Friedensnobelpreisträgerin zu den
Rohingyas ...)
Eltern aus Prenzlauer Berg dürften die Heiligenbilder angesichts des
Reifen-profils der Busse kaum beruhigen. Bar jeglichen ökologischen
Dünkels baut ein Obstverkäufer im Auspuffqualm aus seinen polierten
Red Apples aus China eine Tetrispyramide. Neben den üblichen fettgetränkten
Delikatessen zum Frühstück verbreiten die Zeitungsjungs geistiges
Futter. Dreist bauen sich Mönchleins vor dem Einstieg des Busses auf, um
zu ihren Scherflein zu kommen – Geld oder keinen Segen. Das Gros der
Beute wird also auch hier nicht auf der Pirsch, sondern vom Ansitz aus erlegt (ob
mit Anstand?) …
Nachdem Getreidesäcke und allerlei Krämerwaren verladen sind, finden
auch unsere Rucksäcke Platz im Gepäckraum. Anders als in Laos erstehen
sich
nach Verlassen des Busbahnhofs keine Rumhänger einen Gangplatz für lau.
Durch eine weite Ebene entlang zahlreicher
Fischteiche zieht sich die vollgestopfte Landstraße. Erst nach gut
zweieinhalb Stunden erreichen wir die Hügelkette jenseits des
Sittoung.
Nachdem wir die Reisfelder und den Wasserspinat verlassen haben, treffen wir auf Gemüse und Obstbäume in
.jpg) den
Hügeln und nach gut fünf Stunden in der Pilgermetropole
Kinpun ein. den
Hügeln und nach gut fünf Stunden in der Pilgermetropole
Kinpun ein.
Der Ort am Fuße der
Kyaikhtiyo Pagode
ist zwar deutlich kleiner als Lourdes oder Fatima,
weist jedoch sämtliche wallfahrtstechnisch wichtigen Merkmale auf:
Hotels für besser Betuchte wie unser zwei, Absteigen für jene, die mühselig
sind und
beladen, eine endlose Gasse, in der sich Futterstation an selbige
reiht, Tante Emma Lädchen, welche alle nur erdenklichen Fertig- und
Halbfertiggerichte sowie sämtlichen weiteren Wallfahrerbedarf feil
bieten, Heiligenbildchen- und.jpg) Votivgabenverkäufer sich an ihre Konkurrenten lehnen und Andenkenetablissements, in denen es nichts gibt, was es nicht gibt. Die
ersten
fünfhundert Meter des Pilgerweges sind nicht nur verkehrsberuhigt, über
ihm liegt trotz der Menschenscharen eine ausgesprochen friedliche, gelassene Atmosphäre, die selbst durch das entfernte Hupen der
zahlreichen ankommenden oder abfahrenden Busse nicht gestört wird.
Einzig der Propagandawagen der Mönche, aus dessen leistungsstarken
Lautsprechern lautes Stimmengeplärr statt zu erwartenden meditativen
Singsangs erschallt, sorgt für Ungemach – Fundamentalisten unter den Buddhisten oder nur Geldeintreiber der Aktion "Unser Buddha
soll schöner werden"?
Votivgabenverkäufer sich an ihre Konkurrenten lehnen und Andenkenetablissements, in denen es nichts gibt, was es nicht gibt. Die
ersten
fünfhundert Meter des Pilgerweges sind nicht nur verkehrsberuhigt, über
ihm liegt trotz der Menschenscharen eine ausgesprochen friedliche, gelassene Atmosphäre, die selbst durch das entfernte Hupen der
zahlreichen ankommenden oder abfahrenden Busse nicht gestört wird.
Einzig der Propagandawagen der Mönche, aus dessen leistungsstarken
Lautsprechern lautes Stimmengeplärr statt zu erwartenden meditativen
Singsangs erschallt, sorgt für Ungemach – Fundamentalisten unter den Buddhisten oder nur Geldeintreiber der Aktion "Unser Buddha
soll schöner werden"?
(Fotos von
der Drosselgass)
Sagt Buddha, dass wir kommen …
...
allerdings nicht zu Fuß den Berg hinauf, sondern im Truck, den wir an
der Pilgerverladestation artgerecht über eine Rampe betreten. Zehner
Vierkanthölzer
.jpg) (nicht
gefast) bilden die Sitzreihen für 40 bis 50 Wallfahrer – in Fatima
leiden die Knie, hier die Backen. Doch besser schlecht gefahren werden
als selbst unter Mühen gut bergan zu pilgern. (nicht
gefast) bilden die Sitzreihen für 40 bis 50 Wallfahrer – in Fatima
leiden die Knie, hier die Backen. Doch besser schlecht gefahren werden
als selbst unter Mühen gut bergan zu pilgern.
Kaum haben wir unsere nicht nummerierten Plätze in der vorletzten
(hart) und letzten (Kante der Ladeklappe, härter) Reihe eingenommen,
geben zwei gelüftete Sonnenbrillen zwei ungeliftete Gesichter frei, die
wir aus Berlin kennen. Mitunter ist die Welt doch klein …
Die
Fahrt im Kleinlaster zur Bergstation verläuft nicht nur rasant, sondern
mindestens so halsbrecherisch und Gesäß verachtend holperig wie in der
einschlägigen Literatur verbreitet. Gut, dass Willi nicht wegen eines
Bandscheibenvorfalls pensioniert worden ist … Ob der kurvenreichen
Buckelpiste und dem unter diesen Bedingungen nur unzureichenden
Gleichgewichtssinn, können wir mit Fotos vom „dschungelartigen Bergwald“
leider nicht dienen.
.jpg) Nach
einem Kassenstopp an der Mittelstation, an der nicht nur das
Beförderungsentgelt verlangt, sondern von den Gläubigen auch eine
Spende erwartet wird – ich glaub’ nix, also geb’ ich nix – fährt’s noch
steiler und haarnadel-kurviger bergan. Die letzten Höhenmeter bis zur
Endstation brettert der Lkw über eine Lehmpiste. Nach
einem Kassenstopp an der Mittelstation, an der nicht nur das
Beförderungsentgelt verlangt, sondern von den Gläubigen auch eine
Spende erwartet wird – ich glaub’ nix, also geb’ ich nix – fährt’s noch
steiler und haarnadel-kurviger bergan. Die letzten Höhenmeter bis zur
Endstation brettert der Lkw über eine Lehmpiste.
Wir
verlassen das Gefährt über eine verchromte Gangway und finden uns als
foreigners von einer Gruppe Sherpas privilegiert umringt. Unsere
Tagesrucksäcke schultern wir alleine; die beiden "anderen Berliner" vertrauen ihr
Reisegepäck einer zierlichen Trägerin an, welche es auf dem Kopf eine
Stunde bergan balanciert.
Zunächst noch auf einer Betonpiste winden wir uns in der grellen
Mittagssonne (Grüße auch an Ewers) dem legendären Felsen entgegen. Den
ersten Teil der Strecke säumen die üblichen Stände, welche vor
Verdursten, Verhungern, bösen Geistern und Langeweile bewahren. Zweimal vier Träger
mit ihren Sänften begleiten uns für eine Viertelstunde - in der Hoffnung, eine der
Langnasen möge doch schlapp machen. Geier über Golden Rock ...
Ein
„Short Cut“ führt über Treppen an „Lädchen“ vorbei, in denen nicht nur
fürs.jpg) körperliche Wohl gesorgt wird, sondern auch alle möglichen Requisiten
und Utensilien zur Abwehr aller Übel sowie zur Förderung des Good Karma
ausliegen. Allein der Anblick abgehackter Ziegen- und Affenköpfe,
verwundener Tausendfüßler sowie undefinierbarer Innereien ermuntert zu
einem kräftigen Schnaps; am besten aus dem Flachmann mit eingelegten
Schlangen, fetten Raupen und Sandelholz …
körperliche Wohl gesorgt wird, sondern auch alle möglichen Requisiten
und Utensilien zur Abwehr aller Übel sowie zur Förderung des Good Karma
ausliegen. Allein der Anblick abgehackter Ziegen- und Affenköpfe,
verwundener Tausendfüßler sowie undefinierbarer Innereien ermuntert zu
einem kräftigen Schnaps; am besten aus dem Flachmann mit eingelegten
Schlangen, fetten Raupen und Sandelholz …
Wieder auf der Piste, stehen wir in der Registrierungsstelle für
einheimische Pilger und, einen Steinwurf weiter, in unserem Hotel. Das
Zimmer im „Mountain Top“ passt, die Betten sind altersgerecht und der
Duschstrahl ist vom Feinsten. Die „Kleinen Dinge“ stimmen schon mal.
(Fotos vom
Aufstieg)
Oh
Buddha …
ich
bin hier – nach einer heißen Dusche und dem Erwerb der „Foreigner Entrance
Fee Card“.
Knapp zehn Minuten schlendern wir am späten Nachmittag bis zum Tor des
Pagodenbezirks. Wallfahrer, Träger, Schulkinder und ganz gewöhnliche
Bewohner der Pilgerdörfer kommen uns entgegen.
Barfüßig betreten wir die Heilige Erde, zu erkennen an den fehlenden
roten Flecken der Betelnussrotze (statt "Kodak Points" gibt's "Spit here"
spots) – no shoes, no sex, no drugs, no Rock’n
Roll, statt dessen nicht unbedingt meditationsfördernde birmesische Heimatklänge.
Der
Findlingsblock, so gülden er auch
schimmert, nimmt sich zunächst nur wenig
.jpg) aus
unter all den gleichfalls gülden schimmernden Gebetshallen. Auf der
„Plaza“ lagern reichlich Pilger in ihren Bezugsgruppen – frisch
verliebte Pärchen, gestandene Familien, wild bunches of youngsters,
Betriebsgruppen und kollektive Glaubensbekenner. Manche ruhen, andere
picknicken, viele tratschen, wenige schauen sich von innen an. Auch auf
der Plattform unterhalb des Goldstücks spielt sich normales Alltagsleben
ab: Wie beim Sonntagsausflug nach Maria Laach posieren Jung und Alt,
Männlein und Weiblein für ein ungestelltes Foto vor einer der heiligsten
buddhistischen Stätten Birmas. aus
unter all den gleichfalls gülden schimmernden Gebetshallen. Auf der
„Plaza“ lagern reichlich Pilger in ihren Bezugsgruppen – frisch
verliebte Pärchen, gestandene Familien, wild bunches of youngsters,
Betriebsgruppen und kollektive Glaubensbekenner. Manche ruhen, andere
picknicken, viele tratschen, wenige schauen sich von innen an. Auch auf
der Plattform unterhalb des Goldstücks spielt sich normales Alltagsleben
ab: Wie beim Sonntagsausflug nach Maria Laach posieren Jung und Alt,
Männlein und Weiblein für ein ungestelltes Foto vor einer der heiligsten
buddhistischen Stätten Birmas.
Business as usual auch in den shops, die Opfergaben feilbieten oder an
den Schaltern, an denen Abziehbildchen mit Blattgold zu erwerben sind –
der Monolith hat an einigen Stellen tatsächlich eine Nachtönung bitter
nötig.
Erst auf den kleinen Terrassen und vor der Altarmauer in Höhe des
Golden Nugget geht es besinnlicher zu: andächtig Betende, still in sich
Versunkene, leise vor sich hin Singende, weltentrückt Meditierende
vermitteln religiöse Ernsthaftigkeit und eine stille Bescheidenheit.
Von
ihr ist an der den Männern vorbehaltenen Blattgoldaufklebestelle aber
auch.jpg) gar nichts zu spüren: Handy in der Linken wird, wem auch immer,
mitgeteilt, dass die Rechte soeben ein Goldplättchen festrubbelt – gut
dass die Linke weiß, was die Rechte tut … Auch ältere ehrwürdige
Vertreter der Lehre lassen sich nicht ganz uneitel mit ernstem Gesicht
und aufgesetztem Heiligenschein beim Goldkleben (geklaubt wurde es
vorher, von wem auch immer) ablichten, nicht selten mit I-Phone …
gar nichts zu spüren: Handy in der Linken wird, wem auch immer,
mitgeteilt, dass die Rechte soeben ein Goldplättchen festrubbelt – gut
dass die Linke weiß, was die Rechte tut … Auch ältere ehrwürdige
Vertreter der Lehre lassen sich nicht ganz uneitel mit ernstem Gesicht
und aufgesetztem Heiligenschein beim Goldkleben (geklaubt wurde es
vorher, von wem auch immer) ablichten, nicht selten mit I-Phone …
So
weit, so Lourdes – doch inmitten all des Gewusels aus Geschäftig-,
Frömmlich-, Oberflächlich- und Frömmigkeit schwingt zwischen all den höchst unterschiedlichen Menschen vor Ort eine ausgesprochen friedfertige,
entspannte Stimmung. Kein entrücktes Dauerlächeln zwischen
ausgebreiteten OMM-Handflächen, doch freundliches Zulächeln, gelassenes Zur-Seite-Treten, zum Foto ermunternde Gesten. Dafür allein lohnt sich
für viele selbst der weiteste Weg, gerade auch in einem geschundenen
Land, in welchem offen gezeigte Religiosität über Jahrzehnte hinweg die
einzig geduldete Form von Opposition war …
(nachmittägliche Fotos)
(weitere Infos zur
Kyiaiktyo Pagode)
Auch wenn die Dunkelheit den Disneylandrummel keineswegs schluckt –
.jpg) die
light show der Kioske und Hallen kommt erst jetzt zur vollen Wirkung – ihr
ist ein gut Teil der feierlichen Stimmung geschuldet, die sich
ungeachtet allen Treibens und aller LED-Heiligenscheine über die Felsenpagode legt. die
light show der Kioske und Hallen kommt erst jetzt zur vollen Wirkung – ihr
ist ein gut Teil der feierlichen Stimmung geschuldet, die sich
ungeachtet allen Treibens und aller LED-Heiligenscheine über die Felsenpagode legt.
(Fotos
am Abend)
Der
Pilgerstrom reißt auch am folgenden Morgen nicht ab, sämtliche Flecken
und Fleckchen sind belagert von Schaulustigen wie von Andächtigen.
Skurril anmutende Alchemisten bewegen sich in kontrollierten,
zeitlupenartigen Tip-Top-Schritten durch die Menge, ein Korb an ihrer
Schultertrage fürs Bargeld, der andere für Sachspenden, pendelnd. Ihre
lederne Kopfbedeckung und die goldene Glocke glänzen in der Morgensonne
ebenso wie der vergoldete Königskopf.
(morgendliche
Impressionen)
Auf
den Boden …
der
Tatsachen bringt uns der „downhill truck“, dessen Höllenfahrt vor allem
in den engen Kurven untermalt
wird durch jugendlich weibliches Gejuchze von der letzten Bank. Sobald
die "Wilde Maus" zu Ende ist, ertönt gar lieblicher Gesang aus den
Kehlen der männlichen Begleiter. Im Ort warten bereits Schlepper der
konkurrierenden Busgesellschaften, um für einen reibungslosen, doch
keineswegs verzögerungsfreien Weitertransport zu sorgen.
.jpg) Am
Spätnachmittag hat sich die Wallfahrerszene im Ort etwas beruhigt.
Mangels der Pilger versuchen Kellnerinnen verschiedener Lokalitäten uns in ihr Etablissement zu locken. Die jugendlichen
Busanimateure halten derweil auf Kreuzungen oder freien Parkplätzen gar
akrobatisch kunstvoll einen geflochtenen Kunststoffball in der Luft und die
Verkäuferinnen in der Ladenzeile schauen in Ruhe zu. Am
Spätnachmittag hat sich die Wallfahrerszene im Ort etwas beruhigt.
Mangels der Pilger versuchen Kellnerinnen verschiedener Lokalitäten uns in ihr Etablissement zu locken. Die jugendlichen
Busanimateure halten derweil auf Kreuzungen oder freien Parkplätzen gar
akrobatisch kunstvoll einen geflochtenen Kunststoffball in der Luft und die
Verkäuferinnen in der Ladenzeile schauen in Ruhe zu.
In
den Seitengassen setzen sich die logistischen Stützpunkte für
Aufstiegswillige fort: weitere Läden und vor allem hühnerfarmmäßig
lang.jpg) gezogene Unterkünfte, die sich hinter Speisegaststätten verbergen.
Auch hier begegnen uns zurückhaltende, freundliche Menschen.
gezogene Unterkünfte, die sich hinter Speisegaststätten verbergen.
Auch hier begegnen uns zurückhaltende, freundliche Menschen.
Heimarbeiter werkeln an Beistellmöbeln aus Bambus; überwiegend gefragt
scheinen kleine Stellagen.
Auch die Malariaprophylaxe betreffend gibt es keinerlei
Beschaffungsprobleme. Einzig die Preise zwingen uns an den Ortsrand –
sobald wir auf Supermarktniveau angekommen sind, riskieren wir ein Auge
…
„Malerisch eingebettet …
in sanft geschwungene, grüne Hügel“ (Loose) liegt
Mawlamyaing (auch: Mawlam-yine)
tatsächlich. Um jedoch der Stadt mit ihren ausgesprochen zuvorkommenden,
.jpg) liebenswürdigen
Menschen, die einem gerne und völlig uneigennützig helfen, einen
„verträumten, exotischen Charme“ (auch Loose) abzugewinnen, muss mensch
entweder Nachtwächter oder auf Trip sein. Wie in so vielen asiatischen
Städten kolonialen Gepräges verkommen auch hier die einst prächtigen
oder doch zumindest ansehnlichen Fassaden zusehends – oder werden im
Boom-Town-Wahn geschleift. Singapore ist für uns Nostalgiker ein
abschreckendes Beispiel, das allerdings überall dort Schule macht, wo
Kommunalpolitiker mittels Spiegelglasfronten Prosperität und sich zur
Schau stellen - wollen. liebenswürdigen
Menschen, die einem gerne und völlig uneigennützig helfen, einen
„verträumten, exotischen Charme“ (auch Loose) abzugewinnen, muss mensch
entweder Nachtwächter oder auf Trip sein. Wie in so vielen asiatischen
Städten kolonialen Gepräges verkommen auch hier die einst prächtigen
oder doch zumindest ansehnlichen Fassaden zusehends – oder werden im
Boom-Town-Wahn geschleift. Singapore ist für uns Nostalgiker ein
abschreckendes Beispiel, das allerdings überall dort Schule macht, wo
Kommunalpolitiker mittels Spiegelglasfronten Prosperität und sich zur
Schau stellen - wollen.
Dennoch finden auch wir hier in der
Verwaltungsmetropole des
Mon-States
den ein oder anderen Straßenzug, der unser
verwöhntes ästhetisches Empfinden nicht all zu sehr auf die Probe
stellt.
Unbestritten malerisch eröffnen sich Blicke von einer der zahlreichen
Pagoden, die auf der Kette der Heiligen Hügel liegen, welche die Stadt
von Norden nach Süden durchzieht. Das Licht in dem alten Moulmein bei
Sonnenuntergang entschädigt für vieles.
(Fotos von
der Stadt)
Illiteraten …
sind wir um so mehr, je weiter wir uns nach Süden
begeben. Begegneten uns in Yangon noch Erklärungen und sogar Orts- wie
Straßennamen mit englischen Untertiteln, auf dem Goldenen Felsen zumindest wichtige
Hinweise wie „Toilettes for Foreigners“, so
.jpg) finden
wir hier bestenfalls unverzichtbare Dont’s in lesbarer Druckschrift. finden
wir hier bestenfalls unverzichtbare Dont’s in lesbarer Druckschrift.
Von
unseren Mototaxijungs, die uns birmesisch pünktlich (der zeitliche
Korrekturfaktor entspricht dem der Air Berlin) gegen ZEHN zwei Sturzhelme
überstülpen, spricht einer kein, der andere kaum Englisch – doch bleibt
ihr Wille, unsere Wünsche und Fragen zu verstehen und sich selbst
verständlich zu machen bis zur Verabschiedung im Hotel ungebrochen -
erfolgreich.
So knattern wir auf der Hauptverkehrsstraße weiter
nach Süden, durch Kautschukplantagen, zwischen denen aufgeräumte Dörfer
liegen, bis Kyaikmayaw,
um uns von der Pagode gleichen Namens beeindrucken zu lassen. Schmuck
schaut sie aus, auch wenn uns die im Loose versprochenen „mehrfarbigen.jpg) Glasfenster“ verborgen bleiben. Selbst diese hätten wohl nicht bewirkt,
jenen Bau in ernsthafte Konkurrenz zur Shwedagon Pagode in Yangon treten zu lassen.
Glasfenster“ verborgen bleiben. Selbst diese hätten wohl nicht bewirkt,
jenen Bau in ernsthafte Konkurrenz zur Shwedagon Pagode in Yangon treten zu lassen.
Dafür bieten die sonntäglichen Familienbanden,
die sich am Ufer des benachbarten gesegneten Sees (Baden nur für
Männer) amüsieren, reichlich
Kurzweil.
Der
auf 180 m Länge hingelegte Betonbuddha in einem Nachbartal bei Mudon ist
in seinem Innern von Kopf bis Fuß begehbar. Auf jeder seiner zwei bis
vier Ebenen veranschaulichen ästhetische Beleidigungen in Form von
Reliefs oder Skulpturen Entwicklung und Bedeutung der
.jpg) Lehre.
Bei allem Respekt gegenüber Luthers Kritik an Tetzel und Konsorten lob’
ich mir die Sixtinische Kapelle und ihr gesamtes Drumherum … Lehre.
Bei allem Respekt gegenüber Luthers Kritik an Tetzel und Konsorten lob’
ich mir die Sixtinische Kapelle und ihr gesamtes Drumherum …
Eine Kleinausgabe des Berges Athos, hier steht allerdings eine weitere
Pagode auf dem Gipfelplateau, lockt uns nicht wirklich, zumindest nicht
zum Aufstieg.
Für
den Rückweg wählen die Jungs Nebenstraßen, die uns den Blick auf
ausgedehnte Reisfelder und bizarre Karstformationen gewähren. Die Dörfer
sind etwas kleiner, die Holzhäuser nicht. In einigen der Flecken leben
Buddhisten, Hindus und Muslims gemeinsam, wie es ihre nebeneinander
stehenden „Gottes“häuser vermuten lassen.
(Sehenswürdigkeiten
im Mon Staat)
(Fotos von
der Landpartie)
Menschenfresser …
treffen wir auf der Insel gleichen Namens, Bilu Kyun, eine halbe
Bootsstunde flussabwärts der Großstadt nicht. Stattdessen begegnen wir sehr
freundlichen, höflichen Einheimischen, die sich für unsere Herkunft
interessieren, ihre Hilfe anbieten und kein bisschen verschnupft
reagieren, wenn wir ihrer nicht bedürfen, sondern uns.JPG) einen schönen Tag wünschen und nachwinken.
einen schönen Tag wünschen und nachwinken.
Bereits auf der Fähre zeichnet sich ab, dass nicht
nur Mon
auf dem Eiland (ein Viertel der Fläche Berlins) leben. So ziemlich alle
in der Provinzhauptstadt vertretenen Ethnien haben sich auch hier
niedergelassen, bestellen die weiten Reisfelder oder arbeiten auf den
Kautschukplantagen, welche sich fast ausnahmslos in Privatbesitz befinden.
Wir
müssen uns beim Hafenmeister preußisch penibel registrieren lassen und
.jpg) treffen
danach im wirklichen Leben auf eine ländliche Welt, in der Zeitchen sehr
viel langsamer zu vergehen scheint. Die Holzaufbauten der LKWs und Busse
können schlecht rosten, die Motoren leicht repariert werden – Modelle
aus den vierziger und fünfziger Jahren, die laufen und laufen und laufen
… PKWs gibt’s nicht – Mopeds entstammen dem vergangenen Jahrtausend.
Pferdedroschken und Ochsengespanne bewältigen den ÖPNV und wenn hier
Zeit Geld wäre, bewegten wir uns unter lauter Millionären. treffen
danach im wirklichen Leben auf eine ländliche Welt, in der Zeitchen sehr
viel langsamer zu vergehen scheint. Die Holzaufbauten der LKWs und Busse
können schlecht rosten, die Motoren leicht repariert werden – Modelle
aus den vierziger und fünfziger Jahren, die laufen und laufen und laufen
… PKWs gibt’s nicht – Mopeds entstammen dem vergangenen Jahrtausend.
Pferdedroschken und Ochsengespanne bewältigen den ÖPNV und wenn hier
Zeit Geld wäre, bewegten wir uns unter lauter Millionären.
Gewiss, nach der Ankunft eines Bootes „tobt“ das Leben im Hafenviertel;
eine Nebenstraße weiter träumt der Ort still vor sich hin.
Ein
vorgezeigtes Schießgummi weckt beim Hafenmeister die gewünschte
Assoziation: Er nennt uns den Ort, schreibt sogar den Namen auf, in dem
es produziert wird, ruft zwei Mototaxis herbei und instruiert die
jungen Fahrer, was sie uns auf dem Weg ins Innere der Insel sonst noch
zeigen sollen. Einmal mehr ist Zeichensprache die lingua franca …
Eine gute halbe Stunde lang holpern wir auf einem schmalen Teerstreifen
durch.JPG) ausgedehnte Reisfelder (von frisch geflutet über satt grün bis
abgeerntet braun), ziehen die Aufmerksamkeit der Einheimischen auf uns,
ernten Lächeln und Winken sowie das ein oder andere „Hello“, bevor wir
in einem Dorf hinter einer Hügelkette auf „Mr. Dunhill“ treffen, der
nach den Abbildungen eines Katalogs dieser Marke Pfeifenköpfe dreht und
drechselt. In Yangon werden sie vermarktet, nicht von ihm …. In seiner
Freizeit schnitzt er Schäfte für Kugelschreiber. Die verkauft er
auf eigene Rechnung.
ausgedehnte Reisfelder (von frisch geflutet über satt grün bis
abgeerntet braun), ziehen die Aufmerksamkeit der Einheimischen auf uns,
ernten Lächeln und Winken sowie das ein oder andere „Hello“, bevor wir
in einem Dorf hinter einer Hügelkette auf „Mr. Dunhill“ treffen, der
nach den Abbildungen eines Katalogs dieser Marke Pfeifenköpfe dreht und
drechselt. In Yangon werden sie vermarktet, nicht von ihm …. In seiner
Freizeit schnitzt er Schäfte für Kugelschreiber. Die verkauft er
auf eigene Rechnung.
Die
Schießgummiproduktion im Nachbardorf ist fest in Familienbesitz und wird
uns vom Sohn des Hauses, der auf seine Zulassung als Anwalt wartet,
recht anschaulich und in gutem Englisch nahe gebracht. Nicht alles, was
fast so aussieht (innen feucht und außen trocken), ist auch ein
Fromms. Erklärungsbedarf wird in Berlin bei einem Glas Wein gedeckt …
.jpg)
Übrigens,
diese Gummis gehen in die ganze Welt, auch nach Europa, über Yangon!
Auf
dem Rückweg leistet Barbara mit einem Fotoausflug in ein Reisfeld einen
erheblichen Beitrag zur Kurzweil bei „Bauers Leut“.
Zurück am Fähranleger sorgt die Ankunft eines Lastkahns für weitere
Verteilungskämpfe unter den TrägerInnen. Sobald die Vehikel auf dem
Vorplatz beladen sind, tuckern sie ins Innere der Insel. Kaum ist der
Spuk vorbei, versinken Mensch und Tier wieder im Halbschlaf – aus dem
uns ein höchst kommunikativer pensionierter Beamter aus der höheren
Verwaltungsebene holt, der bestens über das aktuelle Geschehen in der
Welt informiert ist und den „Great Leadern“ seines Landes keineswegs
unkritisch gegenüber steht. Zum Dank für das Gespräch und weil wir Gäste
sind in seinem Land, lädt er uns auf eine Cola ein.
(Fotos von
der Menschenfresserinsel)
Kartoffelfeuer
…
sind es nicht, die in dieser Gegend flackern, gut
50 Kilometer von Mawlamyaing entfernt, mitten auf dem platten Lande.
Drei Stunden quält sich der Bus über die brettebene Karikatur einer
Landstraße, welche durch Reisfelder, Kautschuk- und Cashewplantagen nach
Hpa An
führt. Der Ort liegt
im Kayin-State
an einem Knie des Tanlwin, umgeben von Karsthügeln, die wer auch immer
einstmals beim Bleigießen hier vergessen hat.
Unser "Zimmer mit Aussicht" zeigt bei
Sonnenuntergang, woher unser Guesthouse.JPG) seinen schmückenden Namen "Golden Sky" entlehnt hat - zu jedem anderen
Zeitpunkt wäre ein leicht angeschmuddeltes "Earl Grey" eher angemessen. Dagegen schimmert die Schwe Yin Pagode in unmittelbarer Nachbarschaft
tatsächlich gülden. Im Abendprogramm legt sich allmählich leichter
Dunst über den breiten Fluss und die weiten Reis- und Gemüsefelder. Er
mischt sich mit dem Rauch der in der Dunkelheit auflodernden
Strohfeuer, die auch der Nase zu verstehen geben, dass hier das Land die
Stadt dominiert.
seinen schmückenden Namen "Golden Sky" entlehnt hat - zu jedem anderen
Zeitpunkt wäre ein leicht angeschmuddeltes "Earl Grey" eher angemessen. Dagegen schimmert die Schwe Yin Pagode in unmittelbarer Nachbarschaft
tatsächlich gülden. Im Abendprogramm legt sich allmählich leichter
Dunst über den breiten Fluss und die weiten Reis- und Gemüsefelder. Er
mischt sich mit dem Rauch der in der Dunkelheit auflodernden
Strohfeuer, die auch der Nase zu verstehen geben, dass hier das Land die
Stadt dominiert.
Dieser Eindruck bestätigt sich am nächsten
Morgen beim Schlendern durch die
.jpg) belebten
Straßen, in denen es zwar geschäftig zugeht, die Uhren jedoch mindestens einen Schlag langsamer ticken als in den Orten, die wir
bisher kennengelernt haben: Deutlich weniger Pickups und fast gar keine
Personenwagen zwängen sich durch die von Verkaufsständen eingeengten
Gassen, Fahrradrikschas sind zahlenmäßig ebenso stark vertreten wie
Mototaxis, es ertönt kaum Gehupe - und nur selten Geklingel, die
Einheimischen bewegen sich "mitten auf dem Damm" - und das sehr
gemächlich. Sie schauen uns ausgiebig an, wohlwollend freundlich, ein
wenig neugierig vielleicht, was uns Langnasen wohl in ihre Stadt
geführt haben mag. belebten
Straßen, in denen es zwar geschäftig zugeht, die Uhren jedoch mindestens einen Schlag langsamer ticken als in den Orten, die wir
bisher kennengelernt haben: Deutlich weniger Pickups und fast gar keine
Personenwagen zwängen sich durch die von Verkaufsständen eingeengten
Gassen, Fahrradrikschas sind zahlenmäßig ebenso stark vertreten wie
Mototaxis, es ertönt kaum Gehupe - und nur selten Geklingel, die
Einheimischen bewegen sich "mitten auf dem Damm" - und das sehr
gemächlich. Sie schauen uns ausgiebig an, wohlwollend freundlich, ein
wenig neugierig vielleicht, was uns Langnasen wohl in ihre Stadt
geführt haben mag.
Wohlwollend freundlich begegnen uns auch
die Menschen auf dem Markt. Sie grüßen lächelnd, ob Gemüseverkäufer oder
Fischhändlerin. Barbara wird das Päckchen Waschpulver, nach dem wir uns
von Stand zu Stand durchgestikulieren, als Präsent überreicht. Und der Wirt eines.jpg) Restaurants lässt uns eine Cola vom Stand gegenüber besorgen, die wir an
einem seiner Tische leeren dürfen - froh (und vielleicht ein wenig
stolz) darüber, dass wir seine Gäste sind, denen sein Land mit all den
Menschen so gut gefällt.
Restaurants lässt uns eine Cola vom Stand gegenüber besorgen, die wir an
einem seiner Tische leeren dürfen - froh (und vielleicht ein wenig
stolz) darüber, dass wir seine Gäste sind, denen sein Land mit all den
Menschen so gut gefällt.
(Infos zum
Volk der Karen)
(... und zu
Sehenswürdigkeiten)
(Fotos aus dem Ort)
(morning
grey and golden sky)
Wirklich beeindruckend …
ist auch beim „vielleicht schönsten
Höhlen-Heiligtum (!) der Welt“ (so bei Loose)
.jpg) vor
allem die Landschaft, in welcher die Felsengruppe liegt: Inmitten einer
weiten Ebene des Thanlwin, in der großflächige Reisfelder in allen hellen Grüntönen im frühen Sonnenlicht schimmern, wachsen
bizarr geformte Karstberge in den Himmel. vor
allem die Landschaft, in welcher die Felsengruppe liegt: Inmitten einer
weiten Ebene des Thanlwin, in der großflächige Reisfelder in allen hellen Grüntönen im frühen Sonnenlicht schimmern, wachsen
bizarr geformte Karstberge in den Himmel.
Die
zahllosen Reliefbuddhas, die zu verschiedenen Ornamenten gruppiert an Wänden und der Decke des Felsentempels Kawt Gon kleben, sind weniger
ihrer fein ausgearbeiteten Details als ihrer Menge wegen faszinierend –
mitunter.jpg) macht’s halt die Masse. Auch ansonsten waren bei der Gestaltung der
unterschiedlichen Buddhafiguren und Altarbilder keine Meister à la
Riemenschneider am Werk.
macht’s halt die Masse. Auch ansonsten waren bei der Gestaltung der
unterschiedlichen Buddhafiguren und Altarbilder keine Meister à la
Riemenschneider am Werk.
Wichtiger für die Anhänger der Lehre ist der Ort, weniger das
Gegenständliche eines Symbols. Und heilige Orte gibt’s hier ebenso
zahlreich wie in Bayern, wo auf jedem Maulwurfshügel ein Gipfelkreuz
thront – hier sind’s halt Stupas oder Pagoden ...
In der neben unserer Unterkunft hätten wir unseren letzten
Sonnenuntergang im Ort verbracht, wären wir nicht noch auf den Ba Bhu,
einen der zahlreichen Maulwurfshügel jenseits des Flusses gestiegen.
Nach gut vierzehn Tagen beenden wir unsere Exkursion in die südlicheren
Gefilde des Landes und kehren zunächst nach Yangon zurück.
(Fotos von
Höhlen und Landschaft)
("Augen"blicke vom Ba Bhu)
Downtown Yangon …
erschlägt uns bei der Rückkehr weitaus weniger denn bei unserer ersten
Ankunft aus wohlgeordneten, übersichtlichen und rasch einzuordnenden
mitteleuropäischen Stadt-, Sozial- und Verhaltensstrukturen, klar
umrissenen Hygienestandards und ausgefeilten ästhetischen Normen, die
uns nicht erst die Renaissance hinterlassen hat ...
Morbide Bausubstanz haben wir während der vergangenen drei Wochen
straßenzügeweise auch in anderen Orten erlebt – und gelernt, dass Auf-
bzw. Erbauen die eine Sache ist, Werterhalt persönlichen wie
gesellschaftlichen Eigentums (nicht nur im Sinne der
Denkmalpflege) hingegen eine ganz andere. Tja, die DDR so nah … Auch in anderen Städten
ist der Gang über Gehwege oder Straßen zum Crosslaufen
mutiert. Und den Straßenzügen in der Hauptstadt, die auf einer Länge von 100 m
im Laufe von zehn Minuten
die jährliche Feinstaubbelastung in der Silbersteinstraße um ein Vielfaches übertreffen, schlagen wir zwei Schnippchen,
indem wir in die Seitengassen ausweichen.
.jpg) Hier
tobt das Leben, das wir schätzen, eher leise vor sich hin: Kaum Autoverkehr, paar zaghaft
klingelnde Trishaws, doch jede Menge Einheimischer, die „auf
Einkaufsbummel“ in ihrem Marktviertel unterwegs sind, und die sich an
uns, welche nur gaffen und nix kaufen, kein bisschen stören. Im
Gegenteil: Auch hier wird uns vermittelt, dass mensch sich freut, uns
"foreigner" in ihrem Viertel willkommen zu heißen. Ihr „Minga la bar“ ist
mehr als eine bloße Grußformel – sie ist sehr viel aufrichtiger
gemeint als so manches „Grüß Gott“. Hier
tobt das Leben, das wir schätzen, eher leise vor sich hin: Kaum Autoverkehr, paar zaghaft
klingelnde Trishaws, doch jede Menge Einheimischer, die „auf
Einkaufsbummel“ in ihrem Marktviertel unterwegs sind, und die sich an
uns, welche nur gaffen und nix kaufen, kein bisschen stören. Im
Gegenteil: Auch hier wird uns vermittelt, dass mensch sich freut, uns
"foreigner" in ihrem Viertel willkommen zu heißen. Ihr „Minga la bar“ ist
mehr als eine bloße Grußformel – sie ist sehr viel aufrichtiger
gemeint als so manches „Grüß Gott“.
Paar Schritt vom Hotel entfernt begegnen wir einmal mehr höflichen und freundlichen Leut’, welche uns notfalls bei der Hand nähmen,
um uns zum gesuchten Ort zu führen. Verirren wäre theoretisch möglich,
nicht wieder zurück zu finden mit Sicherheit nicht.
Am
Fahrkartenschalter der Fähre durchs Delta treffen wir auf Profis, die
uns gleich ansehen, wo unsere langen Nasen lang wollen. Unausweichlich
landen wir im Büro einer Respektsperson, die erst ihren Buddha mit
Wasser und Räucherstäbchen beglückt, bevor sie uns ausgesprochen
zuvorkommend über Abfahrtszeiten und Fahrpreise informiert. Korrekt wie
er es von den Briten gelernt hat, stellt der Senior Chief die Tickets
aus, brieft uns das Prozedere des Einschiffens und wünscht uns noch „a
nice stay in my city“.
(Fotos aus
einer Seitenstraße)
„Push Key!“ …
weckt, wenn nicht als Aufforderung verstanden, zumindest bei Berlinern
gewisse Assoziationen – und in der Tat hat es etwas mit dem „Häuschen“
zu tun, resp. dem Zugang für Touristen dazu, denen man für ihr
Vermögen, welches die Kabine auf der Fähre nach Pathein fordert,
zumindest eine „Special Toilet for Foreigners“ a.jpg) ngedeihen
lassen möchte. Der Schlüssel zum Auftritt im Abtritt ist ins Schloss zu
drücken, nicht, bis es zu spät ist, in selbigem zu drehen
… ngedeihen
lassen möchte. Der Schlüssel zum Auftritt im Abtritt ist ins Schloss zu
drücken, nicht, bis es zu spät ist, in selbigem zu drehen
…
Vor dem ersten Versuch sind bereits Stunden
vergangen: persönliche Begrüßung durch den Senior Chief am Counter der
IWT, Einweisung zur richtigen Jetty (von wegen Zielangabe in
vereinfachter Schulausgangsschrift …), gesittetes Gedrängel vor der
Landungsbrücke, ungezählte helfende Hände, welche uns erst an Bord,
dann, nicht zuletzt unseres Aussehens wegen, aufs upper deck (Cabin
Class) helfen und schließlich der „purser on duty“, der uns „Suite # 5“
zuweist. Schön, dass er sich auch ganz ohne Englischkenntnisse einen
sehr englischen Humor angeeignet hat, noch schöner, dass er während der.jpg) gesamten Fahrt ein wohlwollend aufmerksames Auge auf uns richtet,
welches
unsere Wünsche abliest, noch bevor wir sie uns bewusst machen – und am
schönsten, dass alle anderen Passagiere (wir sind nur vier foreigner
an Deck) ebenso ticken.
gesamten Fahrt ein wohlwollend aufmerksames Auge auf uns richtet,
welches
unsere Wünsche abliest, noch bevor wir sie uns bewusst machen – und am
schönsten, dass alle anderen Passagiere (wir sind nur vier foreigner
an Deck) ebenso ticken.
Unglaublich, auch wenn es den Anschein hat, jeder kümmere sich nur um
sein durch seine Bambusmatte ausgelegtes Revier: Hier achtet auch in der
Holzklasse jeder auf jeden, jeder auf alles und alle. Zwar rückt niemand unbedingt auch nur einen Zentimeter zur Seite, doch wenn ein Schritt
gesetzt werden muss, ist Platz für zwei. Wenn mensch sich bei der Suche
nach einem Bier in die Teestube (für Frauen) verirrt, zeigen hundert Finger und
lächelnde Gesichter in die
richtige Richtung (aufs Achterdeck hinter dem Maschinenraum) – und auf
dem Rückweg wird Raum geschaffen für einen ungefährdeten
Alkoholtransport …
.jpg) Während
der Dämmerung laufen wir in den
Twante-Canal ein, kolonialer
Durchstich, um den Weg von Yangon ins westliche Delta auch
während der „Trockenzeit“ über den
Hauptstrom des
Ayeyarwady
(auch:
Irrawaddy) deutlich zu verkürzen. Während
der Dämmerung laufen wir in den
Twante-Canal ein, kolonialer
Durchstich, um den Weg von Yangon ins westliche Delta auch
während der „Trockenzeit“ über den
Hauptstrom des
Ayeyarwady
(auch:
Irrawaddy) deutlich zu verkürzen.
Nach einem Halt in Twante, bei dem wenige Reisende von, viele an Bord kommen, einiges an Waren umgeschlagen und vor allem körperlichen
Bedürfnissen nach Nahrung und Flüssigkeit in allen Formen nachgekommen
wird, treibt es weiter in die Nacht. Boote, die auch nur ein Licht
gesetzt haben, sind Kulanzerscheinungen – die Jungs am Scheinwerfer,
die Ufer wie Strom ausleuchten, die am Ruder und die graue Eminenz auf
der Brücke dürften alle Augen voll zu tun haben, um den Kahn im
Fahrwasser zu halten, ohne all die dunklen Lasten, welche entgegen
kommen, zu versenken. Sollen sie – wir ruhen derweil auf den
altersgerechten Unterlagen und kriegen dabei alle Augen zu!
Der
Morgen präsentiert uns die Landschaft des Deltas wie sie im Loose steht:.jpg) üppiges Grün, wohin das verschlafene Auge blickt. Hinter den
Mangroven-wäldern oder dem Bambusdickicht am Uferstreifen schimmern
unendlich weite Reisfelder zwischen zart grün und abgeerntet braun.
Wasserbüffel passen ins Bild. Wohlhabend wirkende Siedlungen aus
massiven Holzhäusern wechseln mit notdürftig auf Stelzen errichteten
Behausungen aus Bambus-matten und Laubdächern. Fruchtbar ist diese, naja,
von den Kolonialisten urbar gemachte Landschaft zweifelsohne. Drei
Reisernten bei entsprechendem Wasserstand sind möglich. Doch gibt’s hier
eher zuviel denn zuwenig des kostbaren Gutes: Einen satten Meter über der Hochwassermarke liegen die gut 15.000 km2 (!) – erinnert Euch an die
Flut 2008. Hamburg unter seiner Eminenz Helmut Schmidt war nichts
dagegen. Von der Oder und dem Freund eines "lupenreinen Demokraten" ganz
zu schweigen …
üppiges Grün, wohin das verschlafene Auge blickt. Hinter den
Mangroven-wäldern oder dem Bambusdickicht am Uferstreifen schimmern
unendlich weite Reisfelder zwischen zart grün und abgeerntet braun.
Wasserbüffel passen ins Bild. Wohlhabend wirkende Siedlungen aus
massiven Holzhäusern wechseln mit notdürftig auf Stelzen errichteten
Behausungen aus Bambus-matten und Laubdächern. Fruchtbar ist diese, naja,
von den Kolonialisten urbar gemachte Landschaft zweifelsohne. Drei
Reisernten bei entsprechendem Wasserstand sind möglich. Doch gibt’s hier
eher zuviel denn zuwenig des kostbaren Gutes: Einen satten Meter über der Hochwassermarke liegen die gut 15.000 km2 (!) – erinnert Euch an die
Flut 2008. Hamburg unter seiner Eminenz Helmut Schmidt war nichts
dagegen. Von der Oder und dem Freund eines "lupenreinen Demokraten" ganz
zu schweigen …
So lange der Wasserstand stimmt, legen die
örtlichen Fischer ihre Stellnetze aus. Auch bei ihnen ist Teamarbeit
angesagt. Aus den „Krabbenfallen“ kurz oberhalb der Niedrigwassermarke
dürften all die Köstlichkeiten stammen, die nicht nur in der Hauptstadt
eher als delikate Selbstverständlichkeit denn als Besonderheit auf den
Speisekarten aufgeführt sind …
.jpg) Unsere
mentalen Speicherplätze mehr als belegt von den Eindrücken aus dem Delta, gibt’s als Zugabe den
Halt in Myaung Mya – bis auf eine gute Handvoll Passagiere verlassen
alle die Fähre. Reichlich zwei Stunden nimmt das Löschen der in Yangon aufgenommenen Ladung
in Anspruch. Unsere
mentalen Speicherplätze mehr als belegt von den Eindrücken aus dem Delta, gibt’s als Zugabe den
Halt in Myaung Mya – bis auf eine gute Handvoll Passagiere verlassen
alle die Fähre. Reichlich zwei Stunden nimmt das Löschen der in Yangon aufgenommenen Ladung
in Anspruch.
Die Mengen an Waren, die auf dem Ponton zwischen
gelagert werden, entsprechen Großhandelsdimensionen … Es mag
verwundern, warum hier massenhaft Steigen von Eiern gelöscht, andere
– als einzige Zuladung - an Bord genommen werden (Experten der
entsprechenden EU-Kommission dürften um eine Antwort nicht verlegen
sein). Doch in dieser Stadt endet so ziemlich der Weg aller erdenklichen
Handelsgüter aus der Kapitalen: "Broilerfeed CP 910" ist volumenmäßig der Renner neben Kohlköpfen (aus heimischer, nicht aus pfälzischer Ernte),
Red Apples (from where so ever), Weizenmehl, Knabberzeug, Getränkepäckchen,
Keksdosen und Rainbow-Sprayer (zum Versprühen der Giftmischung aus
Bhophal oder so …) werden durch
legitimierte Träger von Bord gehievt.
Die vermeintliche Unordnung hat ein
Lademeister im Griff, dem das digitale Chaosprinzip nicht ganz fremd
sein dürfte: Erst alles raus aus dem Ladedeck, dann vorläufiges
Ordnen auf dem Ponton,.jpg) dort, wo (Speicher-) Platz ist, schließlich der Abtransport durch private Träger an den Adressaten. In diesem wohl organisierten Durcheinander geht absolut nichts verloren –
preußischer Ordnungssinn ließe dieses System mit Sicherheit
kollabieren.
dort, wo (Speicher-) Platz ist, schließlich der Abtransport durch private Träger an den Adressaten. In diesem wohl organisierten Durcheinander geht absolut nichts verloren –
preußischer Ordnungssinn ließe dieses System mit Sicherheit
kollabieren.
Zwischen dem „Wenn alles getan ist“ und dem Ablegen des Bootes gibt’s
kein Schultheiss vom Fass, sondern eine Runde Betel vom Feinsten. Die schmalen Schultern, die unvorstellbare Lasten gestemmt, die
unterschiedlich alten Köpfe, welche selbige aufrecht von Bord
balanciert, die frischen bis verwelkten Hände, die immer dann, wenn es
notwendig war oder sie darum gebeten worden sind, zugepackt und geholfen
haben, sie ruhen ein wenig vor dem Anlegen des nächsten Lastkahns.
Und die Träger haben immer ein Lächeln für uns, einen mitunter derben
Scherz (von der Gestik her) für ihre Kollegen parat und freie Hände für
jeden Mitträger, der ihrer bedarf. Lange her, dass wir ein derartiges Bewusstsein von und für Gemeinschaft in dieser Form erleben konnten – so selbstverständlich als würde uns das Wechselgeld hinterher getragen …
Gewiss, der Obulus von 42 U$ per pax per cabin bed klingt nicht gerade geschenkt
– doch er ist jeden Cent wert, was die netten Begebenheiten und die Erfahrungen während der
Bootstour betreffen; one way reicht allerdings …
(Fotos aus dem Delta)
(weitere Infos
über das Delta)
Per
Cyclo ins „Paradise“ …
- nach dem Sündenfall. Vor beidem kommt zunächst
der „Immigration Officer“, d.jpg) er
auch nach der Unabhängigkeit vor über sechzig Jahren hier noch immer so
heißt.
Als "registrated foreigners" lassen wir uns also per Trishaw in unsere
Hütte radeln, die, hätte sie ihren Namen verdient, zu einer Anhäufung
von Kirchenaustritten führte. Doch die Geschichte über Unterkünfte
(nicht nur auf dem Lande) soll ein andermal erzählt werden. er
auch nach der Unabhängigkeit vor über sechzig Jahren hier noch immer so
heißt.
Als "registrated foreigners" lassen wir uns also per Trishaw in unsere
Hütte radeln, die, hätte sie ihren Namen verdient, zu einer Anhäufung
von Kirchenaustritten führte. Doch die Geschichte über Unterkünfte
(nicht nur auf dem Lande) soll ein andermal erzählt werden.
An unsere Malariaprophylaxe kommen wir problemlos,
„Grand Royal Whisky“ (!) ist hier so verbreitet wie bei uns Coca Cola.
Waschpulver zu finden gestaltet sich nicht ganz so einfach. Zwar werden
unsere Gestik und Mimik auf Anhieb verstanden, doch oft mit
Kopfschütteln oder, wenn wir auf rudimentäre Englischkenntnisse stoßen,
mit „No have!“ erwidert. Andernorts hat man uns ans Händchen genommen
und in den entsprechenden Laden vors richtige Regal geführt, hier deutet
eine Kopfbewegung in die Richtung, die.jpg) Chancen
verspricht – bei chinesischen Ladenbesitzern. Ja, ja, ich hör schon auf,
auch wenn unsere Wirtsleute einmal mehr ins Bild passen … Chancen
verspricht – bei chinesischen Ladenbesitzern. Ja, ja, ich hör schon auf,
auch wenn unsere Wirtsleute einmal mehr ins Bild passen …
Bis auf diese wenigen Ausnahmen landen wir Exoten
einmal mehr unter Einheimischen, denen "foreigner" allenfalls auf der
Durchreise (zwischen zwei Bussen) auffallen. In
Pathein, mit über
300.000 Einwohnern das größte Zentrum des Ayeyarwady Deltas, begegnen
wir Menschen, die unser Anblick überrascht, vielleicht ein wenig
irritiert. Doch nach einem Lächeln oder einem netten Gruß schlägt uns
eine angenehme Aufmerksamkeit entgegen. Mensch nickt uns zu, probiert
alle bekannten Varianten englischer Grußformeln aus, möchte wissen,
aus welchem Land wir kommen und kann’s nicht fassen, dass wir nur seine
Stadt besuchen, nicht etwa weiter „to the beach“ wollen. Was Wunder,
wenn wir bereits am ersten Abend zumindest im Zentrum stadtbekannt sind?
Nach einer Nacht wie in Abrahams Schoß finden wir auf der Suche nach
einem „real good coffee“ ein „Cafe and Cake House“, in dem wir den
sichtlich verlegen kichernden Mädels nicht entlocken können, ob ihre
Maschine auch einen Espresso
.jpg) hergibt.
Ein freundlicher Herr im Laden nebenan kann uns zwar auch keine
Auskunft geben ("I have never been to that shop!"), doch übersetzen – und so kommen wir zu einem ausgezeichneten Frühstück; nicht dem letzten in dieser netten Umgebung.
Auch hier zeigt sich einmal mehr, dass, sobald die Leut’ ihre Scheu vor
uns fremden Wesen verloren haben und uns als Existenzen aus Fleisch
und Blut wahrnehmen, Verständigung über elementare Bedürfnisse kein
Problem mehr darstellt. Und der eine oder andere herzliche Lacher auf
beiden Seiten hilft über Missverständnisse, die nie peinlich sind,
hinweg. Man unterstellt eben niemandem Böses! hergibt.
Ein freundlicher Herr im Laden nebenan kann uns zwar auch keine
Auskunft geben ("I have never been to that shop!"), doch übersetzen – und so kommen wir zu einem ausgezeichneten Frühstück; nicht dem letzten in dieser netten Umgebung.
Auch hier zeigt sich einmal mehr, dass, sobald die Leut’ ihre Scheu vor
uns fremden Wesen verloren haben und uns als Existenzen aus Fleisch
und Blut wahrnehmen, Verständigung über elementare Bedürfnisse kein
Problem mehr darstellt. Und der eine oder andere herzliche Lacher auf
beiden Seiten hilft über Missverständnisse, die nie peinlich sind,
hinweg. Man unterstellt eben niemandem Böses!
Der
Markt, der sich nicht nur in eigens dafür errichteten Gebäuden, sondern
im Kern der Innenstadt abspielt, offeriert alles, was mensch so braucht:
vom Angelhaken über komplette Fischernetze, vom I-Phone über Wecker zum
Aufziehen,.jpg) von der Ingwerwurzel bis zur Chipstüte - freundliche Gesten, die zum
Verweilen einladen und ein Lächeln (obwohl wir weiter gehen) inklusive.
Eine Stadt zum Wohlfühlen, keine Frage …
von der Ingwerwurzel bis zur Chipstüte - freundliche Gesten, die zum
Verweilen einladen und ein Lächeln (obwohl wir weiter gehen) inklusive.
Eine Stadt zum Wohlfühlen, keine Frage …
Auch die Füße sind uns dankbar, bewegen wir uns doch zum ersten Mal auf
sicherem Terrain: betonierte Straßen und Gehwege fast ohne Tücken. Eine
reiche Kommune also? Von wegen, wie wir später erfahren: eine Stadt mit
paar reichen Leuten, die 80% der Mittel für die Sanierung und
Instandsetzung der Fahrbahnen und Gehwege aufbringen. Den Rest
steuert „the government“ bei.
Hier begegnen uns auch zum ersten Mal Mönche, wie
wir sie in Laos kennen- und respektieren gelernt haben: keine Betelnuss
kauenden Gestalten mit Kopfhörern in den Ohren, die in Latschen noch
nach Mittag mit ihrem vierstöckigen Henkelmann vor Restaurants
herumlungern oder am Abend mit einer rosa gekleideten
.jpg) Nonne
Arm in Arm durch ihren Klostergarten schreiten, keine Betschwestern, die
mit Körbchen zum (Geld-)Scheinesammeln in Läden aufkreuzen und ihre
Heilssprüche murmeln, bis die Besitzer um der lieben Ruhe Willen paar Kyat locker
machen. In der Morgenstunde schreitet ein Abt, gefolgt von
seinen Mitbrüdern, barfuß durch die Straßen. Er wartet weder provokativ
vor einem Speiselokal noch vor irgendwelchen Läden. Erst wenn Menschen
mit Gaben auf ihn zu treten, bleibt er stehen. Seine Gruppe wirkt diszipliniert, ernsthaft, Respekt vermittelnd. Das Bild vom verluderten
Mönchswesen in diesem Land wird ein wenig gerade gerückt.
Bleibt die Frage, welche Einflüsse zu einer solch laxen, oberflächlich
wirkenden Haltung eines großen Teils der "Glaubens"brüder beigetragen haben
und ob ihnen die Einheimischen außer an Heiligen Stätten die Achtung
entgegenbringen, wie wir es in Laos und Kambodscha wahrgenommen haben… Nonne
Arm in Arm durch ihren Klostergarten schreiten, keine Betschwestern, die
mit Körbchen zum (Geld-)Scheinesammeln in Läden aufkreuzen und ihre
Heilssprüche murmeln, bis die Besitzer um der lieben Ruhe Willen paar Kyat locker
machen. In der Morgenstunde schreitet ein Abt, gefolgt von
seinen Mitbrüdern, barfuß durch die Straßen. Er wartet weder provokativ
vor einem Speiselokal noch vor irgendwelchen Läden. Erst wenn Menschen
mit Gaben auf ihn zu treten, bleibt er stehen. Seine Gruppe wirkt diszipliniert, ernsthaft, Respekt vermittelnd. Das Bild vom verluderten
Mönchswesen in diesem Land wird ein wenig gerade gerückt.
Bleibt die Frage, welche Einflüsse zu einer solch laxen, oberflächlich
wirkenden Haltung eines großen Teils der "Glaubens"brüder beigetragen haben
und ob ihnen die Einheimischen außer an Heiligen Stätten die Achtung
entgegenbringen, wie wir es in Laos und Kambodscha wahrgenommen haben…
Eine andere Wirklichkeit erklärt uns eine ältere chinesische Dame, die in
ihrem.jpg) Umbrella Shop einige hübsch anzuschauende Exemplare aufspannt und uns
detailliert den Fertigungsprozess schildert, der auf mehrere Familien
und viele Hände verteilt ist. Dem Bambusschirm, dem berühmten pathein
hti, wollen wir auf einem Ausflug in die entsprechenden Werkstätten
außerhalb des Zentrums näher kommen.
Umbrella Shop einige hübsch anzuschauende Exemplare aufspannt und uns
detailliert den Fertigungsprozess schildert, der auf mehrere Familien
und viele Hände verteilt ist. Dem Bambusschirm, dem berühmten pathein
hti, wollen wir auf einem Ausflug in die entsprechenden Werkstätten
außerhalb des Zentrums näher kommen.
(weitere
Infos zu Pathein)
(Fotos aus
der Stadt)
Mit
Rad, Charme, …
doch ohne Melone geleitet uns U Sein Pe auf einer Velotour zu den
Handwerkern, die seine Stadt berühmt gemacht haben. Wohl kaum jemand,
der diese in alle Welt exportierten Schmuckstücke erwirbt, weiß, woher
sie eigentlich stammen. Weder auf dem Nachtmarkt in Luang Prabang noch
in den Souvenirshops
.jpg) südost-asiatischer
Flughäfen baumelt „Made in Pathein“ an den filigranen Werken, die in der
Sonne verblassen und einem tropischen Regen kaum standhalten. südost-asiatischer
Flughäfen baumelt „Made in Pathein“ an den filigranen Werken, die in der
Sonne verblassen und einem tropischen Regen kaum standhalten.
Doch schön anzuschauen sind sie schon – und dass selbst die Feder zum
Öffnen und Schließen der Parasols aus Bambus gefertigt ist, dürfte
nicht nur Imre faszinieren. Einer der zahlreichen Familienangehörigen
führt uns durch seine Werkstatt und scheut weder Mühen noch (gewählte
englische) Worte, um uns den Herstellungsprozess zu veranschaulichen.
Dass wir uns dafür interessieren, genügt ihm. Er möchte uns keines
seiner Produkte aufdrängen …
Unser Vorradler ist ein krekeliger älterer Herr, der uns humorvoll, doch
mit dem gebotenen Ernst, Land und Leute, Lebensbedingungen in der Stadt
und auf dem Lande, vom neuen Regime erhofften Segen und erfahrene Unbill
durch das letztere näher bringen will. Jeden Morgen erweitert er über die
BBC seine Englischkenntnisse – dass ihm die Namen „unserer“ Kanzlerin
sowie des Bundespräsidenten geläufig sind und er über „the recent
troubles“ informiert ist, beschämt uns: Den Namen seines neuen
Regierungschefs finden wir nicht in der alten Auflage unseres Loose,
auch nicht auf Anhieb in unserem Kopf …
Irgendwo am Wegesrand sehen wir einige Halbwüchsige, die sich gegen die.jpg) Zugkräfte von langen Kunststoffbändern stemmen – Heiligabend auf der
Reeperbahn. Ausschließlich mit Körperkraft werden hier die Strippen zu Seilen und
Enden verzwirbelt, die wir im "Bauhaus" oder bei "Niemeyer" gegen teuer
Geld erstehen.
No education – no chance, children have to work for their parents …
Zugkräfte von langen Kunststoffbändern stemmen – Heiligabend auf der
Reeperbahn. Ausschließlich mit Körperkraft werden hier die Strippen zu Seilen und
Enden verzwirbelt, die wir im "Bauhaus" oder bei "Niemeyer" gegen teuer
Geld erstehen.
No education – no chance, children have to work for their parents …
Im
nächsten Dorf lebt der größte Teil der Bevölkerung von irdenen Waren.
Jüngere Familienmitglieder wechseln sich ab, eine Drehscheibe per Fuß in
Gang zu halten, auf der die Großmutter grobe Gebrauchskeramik
hochzieht, welche sich nicht einmal mehr in Birma in die Haushalte
bringen lässt. Chinese plastic sells – entsprechend bescheiden sind die
Lebensverhältnisse.
Nach dem Mangel an Bildung, sowohl seitens ihrer Förderung durch
staatliche Stellen als auch der fehlenden Orientierung weiter
Bevölkerungsschichten („First
you
have to fill your belly!“) macht Sein Pe Vetternwirtschaft, Korruption
und den a.jpg) bsoluten Machterhaltungswillen seitens der Eliten für den
Zustand seines Landes verantwortlich, welches er ebenso wie „my people“
über alle Maßen liebt. Reichlich Tobak zum Nachdenken am letzten Abend
in einer sehr lieb gewonnenen Stadt. bsoluten Machterhaltungswillen seitens der Eliten für den
Zustand seines Landes verantwortlich, welches er ebenso wie „my people“
über alle Maßen liebt. Reichlich Tobak zum Nachdenken am letzten Abend
in einer sehr lieb gewonnenen Stadt.
(Fotos vom
Ausflug mit Sein Pe)
„Fish
for the People“…
prangt wohl eher als Auf- denn als Forderung über den zahlreichen Toren
zu Fischzuchtanlagen, die sich kilometerweit an der Hauptstraße zwischen
Pathein und Yangon entlang ziehen. Bei so reichlich Wasser wird die Not
zur Tugend erklärt und statt Brot und Spielen eben Proteine und Reis
versprochen. Letzterer gedeiht auf der anderen Straßenseite.
Unterbrochen wird dieses Ensemble durch weite Gemüsegärten, in denen von
Brechbohnen bis Wasserkresse alle „veggies“ zu finden sind, durch
Maisfelder, Kokospalmen und Erdnüsse. Die Schwemmlandebene, mit die
fruchtbarste Region Myanmars, ist eben mehr als nur die Reiskammer
des Landes.
Hungern werden die Siedler in dieser Gegend außer nach ungewöhnlichen
Überschwemmungen wohl kaum. Reichtümer anzusammeln dürfte ihnen ebenso
wenig gelingen. Einheimische Agrarerzeugnisse sind billig – welcher
Anteil zur Tilgung der angehäuften Schulden beim großen Bruder
aufzuwenden ist, dürfte eher einem CIA Report zu entnehmen sein, denn
offiziellen inländischen Statistiken. Aus dem Busfenster nehmen wir kaum
äußerlich verwahrloste Menschen wahr. Vielleicht auch wegen des hohen
buddhistischen Feiertags (Neujahrsfest der Karen) sind nur festlich
gekleidete Dorfbewohner auszumachen. Allerdings stehen deutlich mehr
einfache, Stroh gedeckte Hütten mit Wänden aus Bambusmatten
am
Straßenrand
als massive Stelzenhäuser aus Teakholz .
Beim Einrollen in die Hauptstadt passieren wir zahlreiche „fenced areas“,
Neubaugebiete mit augenscheinlich hochwertigen Wohnhäusern, die auch
hier durch hohe Mauern und Natodraht gesichert nur an bewachten
Eingängen zugänglich sind – hübsche neue Welt …
In
Yangon treffen wir mit unserer Wahl der Unterkunft diesmal ins Schwarze:
„Schöner Wohnen“, ein wenig angejahrt, doch sehr gepflegt – um mit Loose
zu sprechen: „Der Holzfußboden schmeichelt den Füßen, die Holz
verkleideten Wände den Augen“. Schön, sich vor dem Ende unserer ersten
Etappe noch einmal in einem absolut nicht angeschmuddelten Zimmer
wohl zu fühlen und in blütenweißer Bettwäsche zu nächtigen –
nights in
white satin …
Dass wir beim Frühstück auf der Dachterrasse mit Herbie und Moni, die
mit uns bereits vor knapp drei Wochen den Goldenen Felsen gerockt haben,
am
selben Tisch sitzen,
dürfte kaum jemand als „bloßen Zufall“ abkaufen – iss aber so!
Etwas Besonderes …
bleibt die
Shwedagon Pagode auch beim
zweiten Besuch – nicht nur des Ensembles höchst vielfältig gestalteter
Gebäude (vom gigantischen Stupa über unzählige
.jpg) Schreine
bis zu diversen Gebetshallen) oder der z.T. aufwändigen Ornamente an
Fassaden und Innenwänden (hier findet man sie noch, die Kunst am Bau),
sondern vor allem der Stimmung wegen, die wie ein leichter Schleier über
dem Nationalheiligtum Myanmars liegt - keine spürbare Unruhe, auch wenn
sich gefühlt mindestens ebenso viele Menschen auf dem „gesegneten
Hügel“ bewegen wie auf dem Areal des Golden Rock. Schreine
bis zu diversen Gebetshallen) oder der z.T. aufwändigen Ornamente an
Fassaden und Innenwänden (hier findet man sie noch, die Kunst am Bau),
sondern vor allem der Stimmung wegen, die wie ein leichter Schleier über
dem Nationalheiligtum Myanmars liegt - keine spürbare Unruhe, auch wenn
sich gefühlt mindestens ebenso viele Menschen auf dem „gesegneten
Hügel“ bewegen wie auf dem Areal des Golden Rock.
Nicht, dass die Gläubigen unbeweglich in Andacht
versunken auf den Marmorplatten verharrten oder vor sich hin schwiegen.
Hier wandelt man, gemessenen Schrittes, hier picknickt man auch mit
Kind und Kegel, oft adrett bis festlich gekleidet, hier erzählt und
gestikuliert man – gedämpft. Kein Fußgängerdurchgangsverkehr stört,
keine quäkenden, ferngesteuerten Spielzeugautos kurven einem um die
Zehen, kein Gewusel zwischen den Betenden oder Meditierenden, die sich
vor ihren persönlichen Schutzgeistern,
den
Nats,
verneigen oder vor der Nische tief verbeugen, die ihrem (Geburts-)Wochentag
gewidmet ist. Blumen, Schirmchen, Obstkörbe werden als Gaben
dargebracht. Einzelne, Freundes- oder.jpg) Familiengruppen oder gar Fabrikbrigaden fegen, schrubben, wienern den
Boden der Plattform – eine gute Tat. Andere schlummern oder schnarchen –
zumindest keine wirklich schlechte …
Familiengruppen oder gar Fabrikbrigaden fegen, schrubben, wienern den
Boden der Plattform – eine gute Tat. Andere schlummern oder schnarchen –
zumindest keine wirklich schlechte …
Jedenfalls liegt etwas Feierliches, Erhabenes, tief ernst gemeinte Religiosität über dem Plateau; etwas, das selbst einen abgebrühten
Agnostiker, der zudem aber auch gar nichts mit Esoterik am Hute hat, ein
wenig ergreift und vermittelt, was es mit der „Heiligkeit bestimmter
Orte“ an sich haben könnte.
(Eindrücke
vom Heiligtum)
(Abendstimmung)
Huch, …
wäre uns ob der mittäglichen Temperaturen um die 28 Grad C (plus) und
des
.jpg) fehlenden
einschlägigen Gedudels sowie mangelnder Hinweise auf unbedingt zu
besuchende „ganz andere Weihnachtsmärkte“ doch fast entgangen, dass
eben jenes Fest bei Euch so aktuell ist wie hier die Informationen zum
aktuellen (Hoch-)Wasserstand in den Tiefebenen. fehlenden
einschlägigen Gedudels sowie mangelnder Hinweise auf unbedingt zu
besuchende „ganz andere Weihnachtsmärkte“ doch fast entgangen, dass
eben jenes Fest bei Euch so aktuell ist wie hier die Informationen zum
aktuellen (Hoch-)Wasserstand in den Tiefebenen.
Allerseits eine "Stille Nacht" gehabt zu haben wünschen wir all denen,
die uns klassisch, digital, mental oder telepathisch ein "Frohes Fest"
gewünscht haben oder schon immer mal hätten wünschen wollen und
erst zu Ostern, zu Bunny's Zeiten, dazu kommen …
Aus Kambodschas Hauptstadt, wo die digitalen Kommunikationswege nicht nur frei, sondern auch
leidlich schnell sind, setzen wir noch einen drauf:
Frohes Neues
und einen witterungsunabhängigen "Guten Rutsch"!
Urlaub von den Ferien …
verspricht der erste Tag in einer nicht ganz unvertrauten Umgebung nicht
unbedingt, haben wir doch kurz nach unserer Ankunft in Phnom Penh von
der birmanischen Botschaft die telefonische Auskunft erhalten, die Wartezeiten für die Ausstellung von „Tourist Visa“ bewegten sich
zwischen drei und vier Wochen. Das
.jpg) lähmt uns ein wenig,
schließlich möchten wir zum
einen nicht so lange in Kambodscha verweilen. Zum anderen wollen wir
uns noch keine ernsthaften Gedanken darüber machen, welche alternativen
Reiseziele unser harren könnten, ohne dass wir es denn auch ahnten … lähmt uns ein wenig,
schließlich möchten wir zum
einen nicht so lange in Kambodscha verweilen. Zum anderen wollen wir
uns noch keine ernsthaften Gedanken darüber machen, welche alternativen
Reiseziele unser harren könnten, ohne dass wir es denn auch ahnten …
So
genießen wir den Blick vom FCC auf die Mündung des Tonle in den Mekong
selbst bei Sonnenuntergang nicht ganz so unbeschwert wie im Frühjahr –
und auch unser hochprozentiges Mundwasser will uns am Abend nicht so
recht munden. Nicht einmal das weitgehend unproblematische Hochladen der
Website trägt ernsthaft zur Entspannung bei.
Mit
Zeus (steht auf seinem Motorradhelm), „unserem“ Tuktuk-Fahrer, der bereits im Februar für uns den Bärenführer
gespielt hat, steuern wir am Morgen die Botschaft Myanmars an, wo uns
die Auskunft vom Vortag bestätigt wird. Allerdings erhielte man ein
„Visa on Arrival“, so mensch mit einer birmesischen Airline Yangon
anfliege. Zwingend notwendig sei allerdings die Absprache mit der
Fluggesellschaft. Eine entsprechende Telefonnummer soll ein wenig
trösten. Ansonsten sind die MitarbeiterInnen der Auslandsvertretung
weitaus muffeliger als ihre liebreizenden und entgegenkommenden
Landsleute bei ihnen daheim …
Unsere Jungs an der Rezeption leisten
seelsorgerische Erste Hilfe und telefonieren sich die Finger wund, bis
wir endlich einen kompetenten Salesmanager der
MAI
erreichen. Der macht seiner Funktion in seiner Agentur alle Ehre:
Kompetent, smart, effizient bucht er uns für die fünfte Woche nach
erneuter Einreise auf einen Flug von Yangon nach Siem Reap …
…
nicht weil wir uns dort auch sehr wohl gefühlt haben, sondern weil die
Stadt in.jpg) Kambodscha liegt und damit die Bedingungen für ein weiteres „Visa on
Arrival“ für unseren geplanten dritten Besuch des Landes im Februar
erfüllt sind: Einreise mit birmesischer Fluggesellschaft von einem kambodschanischen Abflugort aus mit OK gebuchtem Weiterflug nach 30
Tagen außer Landes.
Kambodscha liegt und damit die Bedingungen für ein weiteres „Visa on
Arrival“ für unseren geplanten dritten Besuch des Landes im Februar
erfüllt sind: Einreise mit birmesischer Fluggesellschaft von einem kambodschanischen Abflugort aus mit OK gebuchtem Weiterflug nach 30
Tagen außer Landes.
Kreditkarte auf den Tresen, Tickets, Zusage für das Visum bei Ankunft
und die dazu gehörenden Formblätter entgegen nehmen – und schon sieht
die nicht ganz unvertraute Welt über dem Mekong wieder ganz anders aus.
Von wegen Ferien nur noch in der Schweiz …
Auch wenn diese Aktion nach ’ner Mark mehr verlangt, der ungetrübt
unbeschwerte Blick auf die Flussmündung beschert uns eine „Happy Hour“
lange vor ihrem offiziellen Beginn …
Die
folgenden Tage in der Hauptstadt verlaufen entsprechend geruhsam und
während unseres Ausflugs nach Kep ist Entspannung pur angesagt:
Speicherplätze im Hirn werden frei, Nervenenden gehen nur zögerlich
neue Verbindungen ein und selbst der Jahreswechsel raubt uns nicht eine
Mütze wohl verdienten Schlafes: Wir begehen ihn zeitgleich mit der
Einnahme unserer Malariaprophylaxe – und das ist auch gut so.
Mental
aufgerüstet kehren wir nach Phnom Penh zurück, finden das FCC und unsere
„personal waitress“ wohl geordnet und harren dem Morgen, wenn mit der
Rückkehr nach Yangon der „Ernst des Reisens“ in Myanmar seine zweite
Auflage erlebt. Ihr erlest Euch spätestens in vier Wochen mehr darüber,
sobald wir wiederum ein neues Visum beantragen (müssen) – auch an einem Ort, der uns nicht ganz unbekannt ist.
„Ich bin drin!“ …
juchzte vor gut 15 Jahren der Traum mancher Schwiegermutter (so er sich
nicht gerade mit anderer Mütter Töchter in der Besenkammer vergnügte).
Auch wir sind drin – nicht im Netz wie einst der Tennisstar (das ist
hier noch immer so zeitaufwändig wie vor fünf Wochen), sondern in der
„Union von Myanmar“.
Für
ein vom Verständnis der Herrschenden her sozialistisches Land verlaufen
.jpg) Ausstellung des „Visa on Arrival“ wie Einreisekontrollen problemlos,
fast schon unbürokratisch. Uns werden keine Fingerabdrücke per Scanner
genommen, so geschehen bei der Ein- und Ausreise nach/aus Kambodscha,
und auch der sächsische „Gänsefleisch-Blick“ fehlt! Vermutlich sind
sämtliche relevanten Passagierdaten bereits mit der Buchung der
Flugtickets im digitalen System der Einwanderungsbehörde gespeichert –
wie bei der Einreise in den Hochsicherheitstrakt USA eben. Ausstellung des „Visa on Arrival“ wie Einreisekontrollen problemlos,
fast schon unbürokratisch. Uns werden keine Fingerabdrücke per Scanner
genommen, so geschehen bei der Ein- und Ausreise nach/aus Kambodscha,
und auch der sächsische „Gänsefleisch-Blick“ fehlt! Vermutlich sind
sämtliche relevanten Passagierdaten bereits mit der Buchung der
Flugtickets im digitalen System der Einwanderungsbehörde gespeichert –
wie bei der Einreise in den Hochsicherheitstrakt USA eben.
Unsere Lady aus dem
Kung Lay Inn geleitet uns vom Flughafen in
ihre Teakholzsuite - sanfte Wiederkehr in eine nicht ganz unvertraute
Umgebung. Sehr wohltuend der herzliche Empfang hier wie bei Mr.
Phillip, "unserem
Thailänder" tschechischer Herkunft, der einen britischen Pass sein Eigen nennt.
Dennoch ist uns Yangon auch während unserer
vierten Stippvisite vom Stadtbild her kein bisschen liebenswerter
geworden. Wir
teilen die Beobachtungen, die
Cees
Nooteboom vor vierzig Jahren notierte: „Der
Verfall ist unübersehbar (…)“ oder „Der Chef der Abteilung
Straßenpflasterung muss entlassen werden“, wollen seinem
Schlichterspruch jedoch nicht folgen, wonach es „ … etwas für sich
(hat), wenn Gehen nichts Selbstverständliches mehr ist …“.
Beim Organisieren unserer Weiterreise stolpern wir
also über die Reste des Pflasters (wenn darunter wenigstens der
Strand läge, nicht
die offenen Eingeweide des Abwassersystems …) und (emp-)finden, dass es
weniger fehlende Urbanität ist, die uns hier ein fröhliches Leben
erschwert denn fehlende „Oasen“, in denen wir uns wohl fühlen - wie im
FCC zum Beispiel. Vermutlich sind unsere fehl angepassten ästhetischen
Standards hier eben fehl am Platze. Und ob wir einen gewissen Dünkel
leugnen sollten, da wir doch die Viertel asiatischer Städte, ob in
Hanoi, Yogjakarta, Batavia, selbst in Hongkong besonders reizvoll
fanden, die kolonialen Ursprungs sind und vor dem Verfall geschützt
werden? Es bleibt ja noch ein wenig Zeit, uns auch auf die Städte
hierzulande einzulassen - wir sind ja noch jung ...
Zum
Glück machen die Begegnungen und das Wiedersehen mit Einheimischen die
fehlenden Wohlfühlorte mehr als wett!
(unsere Reiseroute vom 4. Januar bis 1. Februar -
zweite Etappe)
Als
Exoten …
mag mensch uns in Pathein angeschaut haben, in
Sittwe sind wir,
den Blicken der Einheimischen nach zu urteilen, offensichtlich vom
Himmel gefallen. Mit uns ist
.jpg) noch eine Handvoll „Foreigners“ gelandet,
die jedoch gleich nach dem Eintrag ins dicke Buch der „Immigration“
weiter reist nach Mrauk U. Hellhäutige Touristen begegnen uns bis zum
Abend fünf oder sechs, was unseren Alienstatus hinreichend erklärt. noch eine Handvoll „Foreigners“ gelandet,
die jedoch gleich nach dem Eintrag ins dicke Buch der „Immigration“
weiter reist nach Mrauk U. Hellhäutige Touristen begegnen uns bis zum
Abend fünf oder sechs, was unseren Alienstatus hinreichend erklärt.
Das Städtchen am
Kaladan, schon seit über
zweitausend Jahren ein wichtiger Hafen und seit knapp zweihundert
Verwaltungszentrum, vermittelt beim ersten Hinschauen einen durchaus
aufgeräumten Eindruck: Breite Hauptstraßen, von massiven Stein- oder
Teakhäusern gesäumt, Läden mit gut gefüllten Regalen und Truhen,
betonierte Fahrbahnen, leidlich begehbare Gehwege. Pickups sind
spärlich, Pkws fehlen ganz, Tuktuks finden sich vereinzelt – Trishaws
dominieren das Bild und klingeln sich durch die Fußgänger, welche die
Straßen ungeniert in Besitz nehmen.
Unser „Noble Hotel“ verdient sich seinen Namen durch die Zimmerpreise –
die Gegenleistungen sind weniger nobel; doch auch daran wird die Welt nicht
zu Grunde.jpg) gehen. Und hier, auf dem Weg durch die Nebenstraßen zum Markt,
auf dem es alles gibt, was es gibt, begegnet uns zum ersten Mal in
diesem Land ganz offensichtliche Armut. Vor allem aus den Gesichtern der
als Tage- oder Stundenlöhner schuftenden Lastenschlepper schauen einen
Mattheit und Hunger an, trotz der vom Betel geröteten Lippen – wohl dem,
der Cyclo fährt, etwas zu verkaufen hat, ein Stückchen Land sein Eigen
nennt oder eines der zahlreichen Taxiboote rudert. gehen. Und hier, auf dem Weg durch die Nebenstraßen zum Markt,
auf dem es alles gibt, was es gibt, begegnet uns zum ersten Mal in
diesem Land ganz offensichtliche Armut. Vor allem aus den Gesichtern der
als Tage- oder Stundenlöhner schuftenden Lastenschlepper schauen einen
Mattheit und Hunger an, trotz der vom Betel geröteten Lippen – wohl dem,
der Cyclo fährt, etwas zu verkaufen hat, ein Stückchen Land sein Eigen
nennt oder eines der zahlreichen Taxiboote rudert.
Obwohl es hier ganz offensichtlich auch Wohlhabende gibt, locker sitzt
das Geld nicht, locker wird es auch nicht verdient, was Wunder, wenn die
meisten Menschen hier nicht locker drauf sind? Das Leben in dieser
Stadt, die Leute, alles wirkt sehr viel härter als wir es in den bisher
bereisten Orten wahrgenommen haben. Es wird gegrüßt, höflich genickt,
mitunter auch gelächelt, doch fehlt, verständlich, die Unbeschwertheit,
der wir bisher überall begegnet sind.
.jpg) Die
Gesichter nicht nur der Erwachsenen scheinen verhärmt, Kinder fordern
auf dem Markt ganz unverhohlen „Money!“, ohne dass ein Älterer
eingreift, Mütter mit ihren Säuglingen auf dem Arm betteln nachhaltig
uns Fremde an und ihre Sprösslinge im Grundschulalter laufen so lange
gestikulierend und zischend hinter uns her, bis sie sich doch noch von einem
Erwachsenen eine saftige Schelle einfangen. Die organisierten „Bettelgangs“ bedienen
einmal mehr das Klischee, welches uns beim Anblick ausgestreckter Hände
südost-europäischer Mitbürger auf dem Tauentzien umfängt – Indien ist nicht weit
und Bangladesh noch näher. Hier wird zudem
Wasser auf die Mühlen
derer gegossen, welche die muslimischen Rohingya auch weiterhin nicht als
Volksgruppe in Birma akzeptiert wissen wollen … Die
Gesichter nicht nur der Erwachsenen scheinen verhärmt, Kinder fordern
auf dem Markt ganz unverhohlen „Money!“, ohne dass ein Älterer
eingreift, Mütter mit ihren Säuglingen auf dem Arm betteln nachhaltig
uns Fremde an und ihre Sprösslinge im Grundschulalter laufen so lange
gestikulierend und zischend hinter uns her, bis sie sich doch noch von einem
Erwachsenen eine saftige Schelle einfangen. Die organisierten „Bettelgangs“ bedienen
einmal mehr das Klischee, welches uns beim Anblick ausgestreckter Hände
südost-europäischer Mitbürger auf dem Tauentzien umfängt – Indien ist nicht weit
und Bangladesh noch näher. Hier wird zudem
Wasser auf die Mühlen
derer gegossen, welche die muslimischen Rohingya auch weiterhin nicht als
Volksgruppe in Birma akzeptiert wissen wollen …
(wiki zur
Volksgruppe der Rohingya).JPG)
(AlJazeera
zur ethnischen Minderheit ...)
(die
ZEIT zum Thema)
(... und bei
CNN)
(Feature:
Exil im eigenen Land)
(wiki zum
Rakhaing Staat)
(Sehenswürdigkeiten
im Rakhaing Staat)
(aus dem Ort
und Hafenszenen)
„Das Land mit viel Reis“ …
wie
Mrauk U,
die untergegangene Hauptstadt des letzten Rakhine Reiches früher hieß,
verdient diesen Namen auch heute noch: Während der gut vierstündigen
Bootsfahrt nehmen die Reisfelder im Schwemmland kein Ende; mehrere
Ernten im Jahr sind möglich. Warum UNICEF in Sittwe dennoch
us-amerikanischen Reis
.jpg) anlanden
lässt, vielleicht kennt (und nennt)
Transparency eine Antwort. anlanden
lässt, vielleicht kennt (und nennt)
Transparency eine Antwort.
Das
„local ferry boat“ nötigt uns morgens bereits vor dem Aufstehen in ein
unbeleuchtetes Tuk-tuk, welches uns durch die dunklen, fast menschenleeren
Straßen karrt. Hier beginnt der Alltag deutlich später als in den
südlich gelegenen Orten. Dafür ist es am Anleger um so belebter: Mehrere Fähren
liegen im Saykonakanal, klar zum Auslaufen.
Zwei kräftige Jungs schultern unser Gepäck und
balancieren es über zwei schmale.jpg) Planken gleich aufs Oberdeck eines Seelenverkäufers, der uns allerdings
mit zwei „kingsize wooden chairs“ verwöhnt. „Senator“ sind wir - in der
Holzklasse. Diese teilen wir uns mit zunächst noch scheuen OberschülerInnen, ihren am frühen Morgen auch noch nicht so
gesprächigen Lehrkörpern und deren Familienangehörigen. Wochenendausflug zu Studienzwecken, wie uns ein bei den jungen Damen
recht beliebter Junglehrer zuschmunzelt, in ein Stück Vergangenheit ...
Planken gleich aufs Oberdeck eines Seelenverkäufers, der uns allerdings
mit zwei „kingsize wooden chairs“ verwöhnt. „Senator“ sind wir - in der
Holzklasse. Diese teilen wir uns mit zunächst noch scheuen OberschülerInnen, ihren am frühen Morgen auch noch nicht so
gesprächigen Lehrkörpern und deren Familienangehörigen. Wochenendausflug zu Studienzwecken, wie uns ein bei den jungen Damen
recht beliebter Junglehrer zuschmunzelt, in ein Stück Vergangenheit ...
…
zumindest in ein kleines, ruhiges, recht verschlafen wirkendes Städtchen
mit niedrigen Häusern, in dem selbst der Sekundenzeiger nicht aufgeregt
weiter springt – und die ob der angekommenen Touristen interessiert schauenden
Einheimischen schon gar nicht. Eine Handvoll aufgemotzter Willys aus WW
II verkehrt zwischen
.jpg) Jetty und „Downtown“, ansonsten bestimmen Cyclos, was auf der Straße geschieht, oder Radfahrer und Fußgänger. Jetty und „Downtown“, ansonsten bestimmen Cyclos, was auf der Straße geschieht, oder Radfahrer und Fußgänger.
Dass wir nicht in einer Derek freien Zone gelandet sind, zeigen nicht
nur zahlreiche Satellitenschüsseln, sondern auch die Frisuren einiger
Youngster. Schräge Schnitte auf dem Kopf, doch die Beine stecken noch
immer in Longyis … Traditionell ist auch die Höflichkeit, mit der uns
die meisten Menschen hier begegnen: Freundliches Grüßen gerade auch in
den engen Gassen der Wohnbereiche, Eltern, die ihre Kleinkinder zum
Winken.jpg) animieren, Lächeln allerorten. Wir sind wieder auf dem Lande, wo
nicht jeder viel hat, doch genug, um nicht zu hungern … animieren, Lächeln allerorten. Wir sind wieder auf dem Lande, wo
nicht jeder viel hat, doch genug, um nicht zu hungern …
(wikitravel
zu
Mrauk U)
(Fotos
von
der Bootsfahrt)
(Fotos
aus Mrauk U)
(... und der
Tobacco Road)
(Infos zu
Cheroots)
Weniger.jpg) ob der von sehr unterschiedlichen Baustilen und Anordnungen her
interessanten Pagoden als einmal mehr der ländlichen Idylle wegen lohnt
sich eine Tour durch das Städtchen, das aus vielen einzelnen kleinen
Dörfern entstanden ist. Unsere Cyclofahrer kutschieren uns durch
holperige Gässchen zurückgezogener Wohngebiete, in denen das Leben noch
einige Takte langsamer abläuft als in „Downtown“. Am Straßenrand wird
gewürfelt, gemeinsam vor dem einzigen Fernsehgerät der Nachbarschaft
gehockt, gekocht, getratscht, gegrüßt. Letzteres mitunter etwas
verhaltener, abwartend, ob sich denn ein Lächeln auf unseren Gesichtern
abmalt, welches
dann meist erwidert wird.
ob der von sehr unterschiedlichen Baustilen und Anordnungen her
interessanten Pagoden als einmal mehr der ländlichen Idylle wegen lohnt
sich eine Tour durch das Städtchen, das aus vielen einzelnen kleinen
Dörfern entstanden ist. Unsere Cyclofahrer kutschieren uns durch
holperige Gässchen zurückgezogener Wohngebiete, in denen das Leben noch
einige Takte langsamer abläuft als in „Downtown“. Am Straßenrand wird
gewürfelt, gemeinsam vor dem einzigen Fernsehgerät der Nachbarschaft
gehockt, gekocht, getratscht, gegrüßt. Letzteres mitunter etwas
verhaltener, abwartend, ob sich denn ein Lächeln auf unseren Gesichtern
abmalt, welches
dann meist erwidert wird.
Auch hier schuften Jung und Alt – ob Wasserträger, die mehrmals am Tag im Laufschritt zwischen Brunnen und Haushalten eilen, Marktfrauen, die
ihre Waren, von der Chipstüte bis zum Babystrampler, in riesigen flachen
Körben auf dem Kopf von Dorf zu Dorf balancieren oder Lastenfahrer,
welche vom Reissack bis zum.jpg) Dachbalken alles, aber auch wirklich alles, auf ihren Trishaws durch die
Schlaglöcher ruckeln. Mehr als verständlich, dass nicht jeder entspannt
den Fremden anschaut, der hier Urlaub macht und für ein, zwei
Übernachtungen einen Betrag aufwendet, mit dem Einheimische einen ganzen
Monat auskommen müssen. Dennoch schwingt keinerlei Missgunst in ihren
Blicken, eher Gleichgültigkeit, weil man eh nicht dazu gehört …
Dachbalken alles, aber auch wirklich alles, auf ihren Trishaws durch die
Schlaglöcher ruckeln. Mehr als verständlich, dass nicht jeder entspannt
den Fremden anschaut, der hier Urlaub macht und für ein, zwei
Übernachtungen einen Betrag aufwendet, mit dem Einheimische einen ganzen
Monat auskommen müssen. Dennoch schwingt keinerlei Missgunst in ihren
Blicken, eher Gleichgültigkeit, weil man eh nicht dazu gehört …
(Sakralbauten bis zum Abwinken)
(Fotos von
der
ländlichen Idylle)
Der
Spinnenfrau …
selbst sind wir nicht begegnet, doch einigen ihrer Schwestern, deren
nicht mehr ganz taufrische Züge dennoch ihre Ebenmäßigkeit behalten
haben und eine Ahnung früherer Schönheit andeuten ...
.jpg) Vor
den
Chin Dörfern
liegt eine gerüttelte halbe Stunde im Tuk-tuk
durch die morgendlichen Dunstschleier über vom Tau feuchten Reisfeldern bis
zur Ablegestelle in einem Dörfchen am Laymyro. Dort herrscht der an
Fährstellen übliche Betrieb. Im Nu versammeln sich alle Altersgruppen
um Bernhard, einem Mitreisenden, der die Zuschauer ob seiner
Jonglierkünste mitreißt. Noch bei unserer Rückkehr am späten Nachmittag
drängen die Kinder begeistert auf "Zugabe"! Vor
den
Chin Dörfern
liegt eine gerüttelte halbe Stunde im Tuk-tuk
durch die morgendlichen Dunstschleier über vom Tau feuchten Reisfeldern bis
zur Ablegestelle in einem Dörfchen am Laymyro. Dort herrscht der an
Fährstellen übliche Betrieb. Im Nu versammeln sich alle Altersgruppen
um Bernhard, einem Mitreisenden, der die Zuschauer ob seiner
Jonglierkünste mitreißt. Noch bei unserer Rückkehr am späten Nachmittag
drängen die Kinder begeistert auf "Zugabe"!
Wir tuckern, nachdem sich die Nebel gelichtet
haben, gemächlich flussaufwärts..jpg) An den zunächst noch recht hohen Steilufern werden statt Reis Mais,
diverse Gemüse, winzige Kartoffeln und Erdnüsse angebaut – viel Grün
fürs noch müde Auge.
An den zunächst noch recht hohen Steilufern werden statt Reis Mais,
diverse Gemüse, winzige Kartoffeln und Erdnüsse angebaut – viel Grün
fürs noch müde Auge.
Behäbige Lastensegler transportieren Flusskiesel nach Sittwe – die neue
Jetty frisst jede Menge Material. Die Hafenstadt ist auch das Ziel der
zahlreichen Bambusflöße, die von dort „gebündelt“ in die Papiermühlen
nach Bangladesh verfrachtet werden.
Ein Pee Stop führt uns zu einem Chin Dorf, in dem
kaum Fremde anlanden. Entsprechend improvisiert wirkt der Marktstand,
den einige ältere Frauen aus ihren Plastiktüten zaubern. Vordringlich
scheint ihnen jedoch eine gebührende
.jpg) Begrüßung
in ihrem Ort. Sie begutachten jeden Einzelnen von uns und lassen sich
ebenso ungeniert und ganz ohne Scheu betrachten. Ihre Tätowierungen
tragen sie so selbstverständlich im Gesicht wie die überzeugten Anhänger
jener Modeerscheinungen in
unseren Breiten. Begrüßung
in ihrem Ort. Sie begutachten jeden Einzelnen von uns und lassen sich
ebenso ungeniert und ganz ohne Scheu betrachten. Ihre Tätowierungen
tragen sie so selbstverständlich im Gesicht wie die überzeugten Anhänger
jener Modeerscheinungen in
unseren Breiten.
Nachdem die Ladies (und nicht nur die) sichtlich Spaß an Bernhards
Künsten gefunden und sich als durchaus geschickte Assistentinnen für den
nächsten Auftritt auf großer Bühne geoutet haben, verlassen wir ihr
aufgeräumtes, ausgesprochen gepflegtes Dorf.
Eine knappe halbe Stunde flussaufwärts betreten wir eine weitere
Siedlung, an deren Strand bereits einige Touriboote liegen. Bis zu acht
Gruppen besuchten täglich diesen Ort steckt uns Nyi Chay, unser guide..jpg) So präsentieren sich Hütten wie BewohnerInnen entsprechend
herausgeputzt und routiniert. Aufmerksam die Begrüßung auch hier, doch
kommt frau rasch zum Geschäft: Muschelketten, gewebte Schals, geknüpften
Armschmuck – verbrämtes Bargeld im Tausch gegen Fotos. Plastiktüten
werden bereit gehalten für erwartete Gastgeschenke. Der Umgang mit
Fremden und das Sich-ins-rechte-(Kamera-)Licht-Rücken gehören zu den
Routineübungen. Selbst die Schule vermittelt einen ungewohnt
ordentlichen Eindruck – Potemkin lässt grüßen …?
So präsentieren sich Hütten wie BewohnerInnen entsprechend
herausgeputzt und routiniert. Aufmerksam die Begrüßung auch hier, doch
kommt frau rasch zum Geschäft: Muschelketten, gewebte Schals, geknüpften
Armschmuck – verbrämtes Bargeld im Tausch gegen Fotos. Plastiktüten
werden bereit gehalten für erwartete Gastgeschenke. Der Umgang mit
Fremden und das Sich-ins-rechte-(Kamera-)Licht-Rücken gehören zu den
Routineübungen. Selbst die Schule vermittelt einen ungewohnt
ordentlichen Eindruck – Potemkin lässt grüßen …?
Auf
der Rückfahrt gleiten wir einmal mehr an schwer beladenen Booten vorbei,
auf denen Muskelkraft Strömung und Wind unterstützen.
.jpg) Sicher,
solche Ausflüge haben oft etwas von Deppentouren, doch gewähren sie
jener Spezies immerhin einen vorsichtig dosierten und ausgewählten
Einblick ins Tagesgeschehen unterschiedlicher Volksgruppen jenseits
größerer Siedlungen ... Sicher,
solche Ausflüge haben oft etwas von Deppentouren, doch gewähren sie
jener Spezies immerhin einen vorsichtig dosierten und ausgewählten
Einblick ins Tagesgeschehen unterschiedlicher Volksgruppen jenseits
größerer Siedlungen ...
(wiki zum
Chin Staat)
(Fotos
bis
zum Anlegen)
(Eindrücke
aus dem ersten Dorf)
(Portraits
der ersten Tattoos)
(Fotos
aus
dem zweiten Dorf)
(… und
von
ausgewählten Einwohnerinnen)
(Absegeln
…)
Off
the beaten tracks …
wandelten wir vorvorgestern. Seit unserer Landung
in
Bagan –
der Flughafen nennt sich Nyaung U – folgen wir den Spuren, die
Generationen des.jpg) internationalen Tourismus vor und mit uns in dieser archäologischen
Schatzkammer leg(t)en. Dank sachdienlicher Hinweise aus der
Bevölkerung und antizyklischen Abklapperns der laut einschlägigen
Reiseführern zu besichtigenden sakralen Bauten gelingt es uns immer
öfter, Erklärungs- und Fotostaus zu vermeiden.
internationalen Tourismus vor und mit uns in dieser archäologischen
Schatzkammer leg(t)en. Dank sachdienlicher Hinweise aus der
Bevölkerung und antizyklischen Abklapperns der laut einschlägigen
Reiseführern zu besichtigenden sakralen Bauten gelingt es uns immer
öfter, Erklärungs- und Fotostaus zu vermeiden.
Und
selbst dort, wo wir mitten hinein geraten, lohnt sich jede Minute (Ab-)Wartens:
Gut 40 Quadratkilometer Tempelareal bieten 2230 aufgelistete Monumente
und mit ihnen eine architektonische Meisterleistung, die wir in den von
uns angesetzten sieben Tagen selbst optisch nicht einmal ansatzweise
bewältigen werden. Einige Kleinode wollen wir uns herauspicken – doch
bereits die Auswahl überfordert uns hoffnungslos. Klickt Euch durch die
Infos und die Bilder, so werdet Ihr verstehen …
(Reiseinfos
zu Bagan)
(lokale Infos
zum alten
Bagan)
(erste
Eindrücke per Rad)
Beeindruckend sind eben nicht nur die Vielzahl der erhaltenen Bauten,
sondern
.jpg) auch
deren unterschiedliche Formen. Hinzu kommt, dass sie unregelmäßig übers
Land verteilt zu finden sind, mal als einzeln stehende Tempel oder
Stupas, mal in größeren Gruppen, umgeben von Buschwerk, Sesamfeldern
oder weiten Gevierten voller gelber Bohnen. Die Ziegelbauten gehören zum
Alltag wie die Kreuzwegstationen in katholisch geprägten Landstrichen.
Und sie stehen nicht nur an befestigten Wegen: Tiefer Sand macht das
Radfahren zu einem Bußgang und lässt uns auf Pferdekarren umsteigen –
hier werden zwar auch nur zwei Räder bewegt, jedoch von vier Beinen,
welche
nicht die unseren sind … auch
deren unterschiedliche Formen. Hinzu kommt, dass sie unregelmäßig übers
Land verteilt zu finden sind, mal als einzeln stehende Tempel oder
Stupas, mal in größeren Gruppen, umgeben von Buschwerk, Sesamfeldern
oder weiten Gevierten voller gelber Bohnen. Die Ziegelbauten gehören zum
Alltag wie die Kreuzwegstationen in katholisch geprägten Landstrichen.
Und sie stehen nicht nur an befestigten Wegen: Tiefer Sand macht das
Radfahren zu einem Bußgang und lässt uns auf Pferdekarren umsteigen –
hier werden zwar auch nur zwei Räder bewegt, jedoch von vier Beinen,
welche
nicht die unseren sind …
(Pagoden
aller Orten)
Balloons over Bagan
…
gesponsert von, mal ganz unbürokratisch notiert, Frau und Kindern zu
Willis Sechzigstem. Sein Kommentar nach der Landung: „Ich möchte noch
mal sechzig werden!“ Euch Vieren nochmals ein ganz heftiges
Dankeschön!!!.JPG)
Noch vor dem Wachwerden karrt uns ein Bus, der fast so alt ist wie die
jüngsten Ruinen, jedoch in deutlich besserem Zustand, zum Startplatz.
Dort lässt man uns dem Vorspiel des Aufklarens beiwohnen: Nachdem die
Ballonhülle mittels eines Gebläses mit Luft gefüllt ist, wird
vorgeglüht (wir haben das an diesem Morgen an uns selbst wohl weislich
unterlassen), bis sich das Luftfahrzeug nebst Korb aufrichtet.
Chriss, voll des britischen Humors, arbeitet
zunächst seinen pre flight check ab, bevor er uns an Bord bittet. Zwölf
im Korb und ab geht die Luzie. Ein Hauch von Sonne kriecht über den
Horizont und rückt morgendlichen Dunst wie alt ehrwürdigen Backstein in
ein angemessenes Licht. Der Gott des Windes lässt uns sanft über die
Pagodenfelder schweben. Den Atem raubt uns der Anblick des Areals voller
Altertümer, die mehr und mehr im Licht der frühen Sonne (er-).jpg) strahlen.
Unvorstellbar, wie reich dieses (ohne die Touristen wohl recht
verschlafene) Nest Bagan als königliche Residenzstadt einmal gewesen
sein muss – vielleicht ein Beispiel für die anicca, den Teil der
buddhistischen Lehre der Unbeständigkeit (für Willi eher
nachvollziehbar als die neubuddhistische der unendlichen Geduld mit dem
und im Internet). strahlen.
Unvorstellbar, wie reich dieses (ohne die Touristen wohl recht
verschlafene) Nest Bagan als königliche Residenzstadt einmal gewesen
sein muss – vielleicht ein Beispiel für die anicca, den Teil der
buddhistischen Lehre der Unbeständigkeit (für Willi eher
nachvollziehbar als die neubuddhistische der unendlichen Geduld mit dem
und im Internet).
Nach unendlich vielen unausgesprochenen AAHS und OOHS und noch immer
im mentalen Schwebezustand ob der faszinierenden An- und Ausblicke
setzen wir hart in einem Stoppelfeld auf. Ein wohl temperierter
Champaign Rosé und leichtes französisches Gebäck zwischen einigen Stupas
dürfte nicht nur für Nichtraucher die Zigarette danach gebührend
ersetzen – ein runder Tag, bereits gegen acht.jpg) Uhr morgens ...
Uhr morgens ...
Übrigens: Die motorisierten
Andenkenverkäufer sind schneller an Ort und Stelle als die Jungs vom
Bergungskommando
…
(Fotos
von
der Ballonfahrt)
(Blicke
von unten)
(unsere Spuren auf
google earth)
Zwei Welten mindestens …
er- und durchleben wir hier (einmal mehr): Den
vierfachen Tageslohn unseres Kutschers geben wir für einen Tag mit ihm
in der Kalesche aus – 4.000 Kyats nimmt er nach sechs Stunden mit nach
Hause, 11.000 streicht der Fuhrunternehmer ein. „Wer hat, dem wird gegeben werden“ ist also auch mit der buddhistischen Lehre kompatibel …
Vielleicht zu unserem Glück: Nehmen es die
Einheimischen doch zumindest äußerlich gelassen und – wie Buddha es
wollte – neidlos hin, dass wir Touristen für zwei Übernachtungen das
Monatsgehalt eines Grundschullehrers über den Tresen reichen. Die
Postkarten-, Andenken-,
Laquerwareverkäufer bleiben freundlich und
scherzen ebenso wie die unzähligen „I am a painter, you know“, wenn man
ihnen partout nichts abkaufen möchte und nach dem x-ten „special price
only for you“ ein müdes „No interest!“ entgegnet. Sie erzählen einem
über „ihren“ Tempel alles,
.jpg) was
sie wissen, zeigen verborgene Winkel, die bestenfalls im Dumont
beschrieben werden, weisen einem versteckt liegende Treppenaufgänge,
die Terrassen erschließen, welche herrliche Blicke auf das Pagodenfeld
eröffnen, und leuchten dem Besucher filigrane Wand- und Deckenmalereien
in dunklen Winkeln aus, ohne dass sie die Hand für ein Bakschisch
aufhielten. Auf Nachfragen erzählen sie von und aus ihrem recht harten
Leben, ohne zu jammern, ohne auf „small money“ zu spekulieren – von Frau
zu Frau, von Mann zu Mann … was
sie wissen, zeigen verborgene Winkel, die bestenfalls im Dumont
beschrieben werden, weisen einem versteckt liegende Treppenaufgänge,
die Terrassen erschließen, welche herrliche Blicke auf das Pagodenfeld
eröffnen, und leuchten dem Besucher filigrane Wand- und Deckenmalereien
in dunklen Winkeln aus, ohne dass sie die Hand für ein Bakschisch
aufhielten. Auf Nachfragen erzählen sie von und aus ihrem recht harten
Leben, ohne zu jammern, ohne auf „small money“ zu spekulieren – von Frau
zu Frau, von Mann zu Mann …
An
der Bootsanlegestelle hingegen hocken Mütter mit ihren Kleinkindern und
halten den Ankommenden Schalen entgegen: organisierte Bettelei um Geld.
Gerade vor den bekanntesten Tempeln posieren sie und verweisen mit
eindeutigen Gesten auf ihre Hunger leidenden Säuglinge. Nahrungsmittel
werden allerdings abgelehnt.
Nebenan schuften Jung und Alt von Früh bis Spät
auf den Feldern, winken, grüßen freundlich, schieben paar nette Brocken
Englisch rüber, wenn man vorbei fährt und lächelt.
.jpg)
Im Dorf Minnanthu vermarkten die Bewohner
den in der Zeit zurückgebliebenen Teil ihres Fleckens. Frau geleitet uns
durch ein Freilichtmuseum, in dem das wirkliche Leben nicht ehrenamtlich
vorgeführt, sondern tagtäglich praktiziert wird. Dabei schielen die
Alten nicht auf Scheine: Sie spinnen, weben, rollen ihre Cherots und
nehmen Besucher als nicht weiter störende Abwechslung hin. Die Jüngeren
deuten dezent an, dass „a small donation for the village people“ gerne
entgegengenommen würde. Doch geschieht das alles unaufdringlich und
ohne zu insistieren - mit Würde eben ...
Bei
alledem bleibt Bagan zwar ein ausgesprochen touristischer, doch immer
noch sympathischer Ort, an dem mensch je nach Tageszeit an den meisten
in Reiseführern beschriebenen Stätten weitgehend ungestört verweilen
kann. Bleibt zu hoffen, dass sich daran auch fürderhin nicht all zu viel
ändert …
(Fotos
vom
südöstlichen Pagodenfeld)
(Auszüge
aus dem Landleben)
(Fotos
aus
dem Dorf)
(portrait of a girl)
(Ansichten
vor dem sundowner)
Seitenanfang
Zum Leben ...
in der
(heimlichen)
Hauptstadt treffen unserem ersten Eindruck
nach Weill und Brecht
mit ihren harten
Weisen wohl den rechten Ton. Gerade auch an
den Ufern des Ayeyarwaddy dürfte das Leben der LastenträgerInnen kein
Zuckerschlecken sein. Auch die Familien, die vom Bambus (ob vom
Transport, Verkauf oder von seiner Weiterverarbeitung) leben, nennen
Behausungen ihr Heim, die eher nach Provisorien ausschauen und doch
ihren gesamten Besitz darstellen.
Und
dennoch begegnet uns kein verärgerter oder gar missgünstiger Blick, als
wir
.jpg) durch
ihre Wohnzimmer, Werkstätten, Arbeitsplätze, Spielwiesen,
Wäschebleichen, Garküchen am Ufer ihres Flusses entlang schlendern. Auch
hier ein Lächeln oder ein freundliches „Hello!“ – mit Stolz präsentieren
sie ihre
Jüngsten, erklärt man uns ob der Falten auf
unserer Stirn, wozu die soeben hergestellten Produkte eigentlich gut
sind (mit Händen und Füßen – des Englischen ist hier niemand mächtig). durch
ihre Wohnzimmer, Werkstätten, Arbeitsplätze, Spielwiesen,
Wäschebleichen, Garküchen am Ufer ihres Flusses entlang schlendern. Auch
hier ein Lächeln oder ein freundliches „Hello!“ – mit Stolz präsentieren
sie ihre
Jüngsten, erklärt man uns ob der Falten auf
unserer Stirn, wozu die soeben hergestellten Produkte eigentlich gut
sind (mit Händen und Füßen – des Englischen ist hier niemand mächtig).
Straßen und Gebäude in „unserem Viertel“ wirken
beim ersten Schlendern weniger herunter als in Yangoon, Gehwege stellen
eine geringere Herausforderung dar, ohne dass dieses Ensemble einen
größeren Charme verströmte. Das Preisgefüge vom Bier bis zum „public
transport“ orientiert sich (saisonabhängig) am Touristenstrom, wobei
die Universaldienstanbieter hier (anders als „bei uns“ in der
Nachwendezeit) den Realitätsbezug nicht verloren haben – die Wachtel in
der Hand ist …
Nach dem Aufspüren von Orten, an denen ernst zu
nehmender Kaffee gereicht.jpg) wird, widmen wir uns den kulturellen Sehenswürdigkeiten – und sind tief
beeindruckt von der Hingabe, mit denen Gläubige völlig unaffektiert die
Mahamuni Statue
verehren. Dennoch: Für uns kommt jene Stimmung, die wir in der Shwedagon
empfunden haben, (noch) nicht auf (Sorry,
Tommy!), doch wir sind ja
(noch) jung – und (noch) einige Tage vor Ort. Und vielleicht treffen wir
ja noch
Kiplings Burma Girl, so die Dame von
Moulmein hierher gefunden haben sollte ...
wird, widmen wir uns den kulturellen Sehenswürdigkeiten – und sind tief
beeindruckt von der Hingabe, mit denen Gläubige völlig unaffektiert die
Mahamuni Statue
verehren. Dennoch: Für uns kommt jene Stimmung, die wir in der Shwedagon
empfunden haben, (noch) nicht auf (Sorry,
Tommy!), doch wir sind ja
(noch) jung – und (noch) einige Tage vor Ort. Und vielleicht treffen wir
ja noch
Kiplings Burma Girl, so die Dame von
Moulmein hierher gefunden haben sollte ...
(Peter
Dawson singt Kipling)
Unsere Universal-undsoweiter wittern unsere
verhalten skeptische Einstellung ihrer Stadt gegenüber und kutschieren uns in
ihren Trishaws durch höchst unterschiedliche Viertel. Vom
mandalayischen Wedding über Tempelhof bis Dahlem und das neue Kreuzberg
kriegen wir alles mit. Prenzl’berg lassen sie aus, die Schwaben fehlen noch und Kinder gibt's überall in der Stadt auch so zuhauf …
Die
beiden setzen uns in einen pick-up zum
Mandalay Hill, der selbst von
Apotheken wie Jan Ullrich einiges abverlangte - und uns ob des diesigen
Himmels nicht den versprochenen „beautiful view“ beschert. Dafür erleben
wir "Einsegnungszeremonien", schreiten das „größte Buch der Welt“ ab und
bestaunen, schon ein wenig matt, vor der Siesta wie 32 Gramm Gold (am Stück) von kräftigen
Männern zu den
hauchdünnen Folien gehämmert werden, welche auch den Mahamuni-Buddha
bis zur Unförmigkeit verändert haben. Am Nachmittag lassen
sie uns
.jpg) Markt- und Handwerkerszenen in Vierteln erleben, die selbst im Lonely Planet noch nicht beschrieben sind. Reichlich Erlebtes also, um uns einen
tiefen Schlaf zu bescheren. Markt- und Handwerkerszenen in Vierteln erleben, die selbst im Lonely Planet noch nicht beschrieben sind. Reichlich Erlebtes also, um uns einen
tiefen Schlaf zu bescheren.
(Sehenswürdigkeiten
in Mandalay)
(Fotos
vom Mahamuni Buddha)
(Rundfahrt
im Trishaw)
(Fotos
vom Shwein Bin Kloster)
Zu
einem guten Karma …
trägt der morgendliche Besuch des Mahamuni-Buddhas rein
fahrzeugtechnisch nicht wirklich bei. Vielleicht, weil wir auch dieses
Mal nicht „die Heiligkeit seiner Stätte“ verspüren, lässt er uns,
nachdem wir einen Blick über die Schultern der
.jpg) Steinmetze
geworfen haben, welche mit Flex, Holzspatel und Stahlschwämmchen
Buddhafiguren nach Maß in Szene setzen (und kolorieren), mit einem
Getriebeschaden unseres „Blue Taxis“ in der Straße der „Buddhafactories“
liegen bleiben. Steinmetze
geworfen haben, welche mit Flex, Holzspatel und Stahlschwämmchen
Buddhafiguren nach Maß in Szene setzen (und kolorieren), mit einem
Getriebeschaden unseres „Blue Taxis“ in der Straße der „Buddhafactories“
liegen bleiben.
Bis zum Eingeständnis des Fahrers, dass er die
Zahnräder ohne fremde Hilfe nicht mehr gerade gebogen bekommt, und wir
besser das Fahrzeug wechselten, verbleibt reichlich Zeit, das lokale
Handwerk hautnah zu erleben. Zum ersten Mal demonstriert uns ein
Glaswerker, ganz richtig, kein Glasbläser,
wie aus Bruch (ob Fensterscheibe oder Bierglas) jene Diademe entstehen,
die sowohl Kronleuchter als auch (vor allem) die Schirme (htilis)
der Pagoden schmücken und im Sonnen- wie im abendlichen Kunstlicht
glitzern –
crazy diamonds
…
Trotz Panne erleben wir Panne: Im Mahagandhayon Kloster geraten wir in
die täglich stattfindende Mönchsspeisung, die zu einem für Touristen
frei gegebenen.jpg) Event ausgeartet ist. Von wem und warum sei zunächst dahin gestellt. Das
Zurschaustellen der Austeilung des „Mittagessens“ ruft nicht nur bei
abgesprungenen Katholiken Bilder der Fütterung von "Knuth at its best“
hervor, es weckt auch schmerzliche Erinnerungen an den Almosengang der
Mönche in Luang Prabang und die leicht zynische Anmerkung eines ihrer
hohen Repräsentanten: „Sometimes monks are like monkeys, you know …“ Aus
meinem zutiefst antiklerikalen Unbehagen stellt sich allerdings die
Frage, wer sich warum und auf wessen Geheiß hier so zum Affen machen
lässt, tagtäglich …
Event ausgeartet ist. Von wem und warum sei zunächst dahin gestellt. Das
Zurschaustellen der Austeilung des „Mittagessens“ ruft nicht nur bei
abgesprungenen Katholiken Bilder der Fütterung von "Knuth at its best“
hervor, es weckt auch schmerzliche Erinnerungen an den Almosengang der
Mönche in Luang Prabang und die leicht zynische Anmerkung eines ihrer
hohen Repräsentanten: „Sometimes monks are like monkeys, you know …“ Aus
meinem zutiefst antiklerikalen Unbehagen stellt sich allerdings die
Frage, wer sich warum und auf wessen Geheiß hier so zum Affen machen
lässt, tagtäglich …
Zur Beruhigung des Gemüts gucken wir uns noch das
ein oder andere Pagödchen in
Amarapura an, erklimmen, reichlich eine halbe
Autostunde entfernt, den
Sagaing Hill mit seinen zahlreichen
Heiligtümern, frönen Willis Hasen (Jahrgang ’51) und einem Frosch (warum
Männer Hüte tragen, Felix - Willi hingegen keine …) ein wenig Aufmerksamkeit
und lassen uns auf
Inwa
herumgiggen.
Unser Kutscher fährt den „Deppentrail“ ab – in der von der
Droschkeninnung festgelegten Reihenfolge. Dazu gehören auch
Heiligtümer, die im Loose ignoriert werden. Unser vergebliches Suchen in selbigem kommentiert
der Mann auf dem Bock mit einem Werturteil: "No orange book - look Planet!" (Lonely ...,
Anm. d. Redaktion).
Das aus Teakholz errichtete Kloster Bagayon
.jpg) hingegen
ist auch für das "orange book" das highlight - zumal sich paar junge
Mönchlein für zwei Dosen Cola vor einheimischen Fotoprofis verbiegen.
Wir profitieren davon ganz parasitär … Das Gebäude selbst strahlt
allerdings etwas Ehrfurcht Gebietendes aus. hingegen
ist auch für das "orange book" das highlight - zumal sich paar junge
Mönchlein für zwei Dosen Cola vor einheimischen Fotoprofis verbiegen.
Wir profitieren davon ganz parasitär … Das Gebäude selbst strahlt
allerdings etwas Ehrfurcht Gebietendes aus.
Pünktlich zum Sonnenuntergang erreichen wir die
U Bein Brücke – leider
gibt der niedrige Wasserstand des Taungthamansees all die Zwiebel- und
Bohnenfelder frei, die bei dem beliebten Fotomotiv üblicherweise unter
Wasser stehen. Dennoch, das Bauwerk aus Teakholz bleibt beeindruckend
und die Stimmung ist trotz des Touristenstroms, der sich mit dem der
Einheimischen mischt, ausgesprochen friedlich, ruhig, unaufgeregt. Dieser
Ort verströmt weitaus mehr Besinnlichkeit als die örtlichen
Pagoden …
Die
Rückfahrt, dem Mahamuni Buddha sei Dank, findet im ersten Drittel ohne
funktionierende Scheinwerfer statt. Erst später wird die nötige
Sicherung erfolgreich ausgewechselt …
(Buddha
factory und crazy diamonds)
(feeding the monks)
(Fotos
auf Inwa)
(U
Bein Brücke)
Das
Leben am Fluss …
wirft wiederum ein anderes Licht auf Mandalay: Im „Bambushafen“ landen
nicht.jpg) nur all die Flöße, hier werden sie auseinander genommen, stangenweise
getrocknet, weiter verkauft und zum Teil auch verarbeitet. Ob zu Matten
oder Hauswänden geflochten, zu Essstäbchen oder Spießchen geschnitzt –
Menschen leben von ihnen …
nur all die Flöße, hier werden sie auseinander genommen, stangenweise
getrocknet, weiter verkauft und zum Teil auch verarbeitet. Ob zu Matten
oder Hauswänden geflochten, zu Essstäbchen oder Spießchen geschnitzt –
Menschen leben von ihnen …
Im
Ölhafen, am Holzpier oder an der Verladestation für Gebrauchskeramik
(100 Liter fassende Krüge dominieren), überall schleppen vor allem
Frauen die schweren Güter von Booten an Land oder auf LKWs – die Männer
sitzen am Ufer und zocken.
(Leben am Ufer)
Bei aller Betriebsam- und Geschäftigkeit geht es
in der größten Stadt des nördlichen Landesteils jedoch ziemlich unaufgeregt
zu.
Unsere Trishawfahrer tun uns Gegenden auf und bringen uns zu Menschen,
welche uns die sanften Weisen von
Elton
.jpg) John zu Mandalay verständlich machen.
Angenehme Begegnungen und Begebenheiten verleihen selbst unserem Viertel
in der alten Königsstadt plötzlich einen gewissen Charme: Einmal mehr auf der
Suche nach Waschpulver, das sonst an jeder Straßenecke zu finden ist,
geraten wir in ein Lädchen für Tierfutter. Die ältere Dame lässt uns in
perfektem Englisch vor einer Tasse Tee, einem netten Plausch auf der
Couch und einem aus den eigenen Vorräten abgefüllten Tütchen "detergent"
nicht mehr los. Außer guten Wünsche für unsere Reise gibt sie uns noch
mit auf den Weg, in Zukunft nach "soap powder" zu fragen. Das sei
linguistisch zwar nicht korrekt, "but people here will better understand, you know …". John zu Mandalay verständlich machen.
Angenehme Begegnungen und Begebenheiten verleihen selbst unserem Viertel
in der alten Königsstadt plötzlich einen gewissen Charme: Einmal mehr auf der
Suche nach Waschpulver, das sonst an jeder Straßenecke zu finden ist,
geraten wir in ein Lädchen für Tierfutter. Die ältere Dame lässt uns in
perfektem Englisch vor einer Tasse Tee, einem netten Plausch auf der
Couch und einem aus den eigenen Vorräten abgefüllten Tütchen "detergent"
nicht mehr los. Außer guten Wünsche für unsere Reise gibt sie uns noch
mit auf den Weg, in Zukunft nach "soap powder" zu fragen. Das sei
linguistisch zwar nicht korrekt, "but people here will better understand, you know …".
Eine Straßenecke
weiter führen uns Jugendliche durchs Angebot der "Family Bakery",
unterscheiden die Geschmacksrichtungen der Leckereien nach sweet, meat,
hot, machen uns auf die Espressomaschine aufmerksam (real good coffee),
räumen ihren Schattenplatz draußen auf dem Gehweg, lassen unsere
Bestellung in der Mikrowelle aufwärmen, erklären uns die Rechnung
Position für Position per Taschenrechner, wünschen uns einen "Bon
Appetit and have a nice stay!" und ziehen zu ihrem nächsten Treffpunkt.
Ist doch charming, oder ...
Ein lohnender Abstecher ...
(lt. Loose) führt uns ins gut drei Busstunden
entfernte
Monywa,
einer Großstadt im Chindwin-District,
in der die einzigen von uns zu deutenden Schriftzeichen mal.jpg) wieder vor
Kneipen hängen, welche
Myanmar Beer
ausschenken . wieder vor
Kneipen hängen, welche
Myanmar Beer
ausschenken .
Der Wortschatz der hier gebräuchlichen lingua
franca besteht überwiegend aus Lächeln, Zuwinken, freundlichem Nicken
und hin und wieder ein paar Brocken Englisch. Alles kein Problem, da die
meisten Einheimischen im Stande sind, uns an der Langnasenspitze
abzulesen, was oder wohin wir gerne möchten.
Bereits am Busbahnhof stürzen sich die
Tuktuk-Geier mit einer gewissen Zurückhaltung und einem sehr fairen
Angebot auf uns. Die Jungs im birmesischen Straßenrestaurant gegenüber
unseres einfachen, doch professionell geführten Hotels verstehen kaum
Englisch, dafür unsere Zeichensprache: Churchills "Victory" endet mit
zwei frisch Gezapften auf dem Tisch - wie benötigt, peanuts inklusive -
Bye, bye,
Herr Ackermann!
Ein wenig Verwirrung stiftet am zweiten Tag,
nachdem die locals unsere Trinkgewohnheiten bereits ausgiebig studieren
konnten (Fassbier beim Birmesen, Essen gleich nebenan beim Chinesen,
abendliche Malariaprophylaxe zum Mitnehmen wieder vom Birmesen),
unsere Order zum Abendessen: Um das Abnagen von Knochen zu vermeiden,
bestellen wir beide „two times Fried Noodles, no meat, with Mixed
Vegetables“. Nun gut, das gibt die zweisprachig (eine können wir nicht
deuten und schon gar nicht lesen) abgefasste Speisekarte so nicht her.
Also rücken wir grundschullehrermäßig das für uns Wichtige ins Blickfeld
und decken den Rest per Daumen ab. Serviert werden einmal „Mixed
Vegetables“, die uns bereits am Mittag hervorragend gemundet haben und –
auch einmal: „Fried Noodles with Mixed Vegetables“. Tja, acht Wochen im
Lande und nix dazu gelernt: Selbstverständlich werden fried noodles
hier fast immer mit
vegetables serviert, ob mit oder ohne Fleisch jedweden Tieres. Mithin
meint unsere Bestellung lokaler Logik folgend: Der eine will „Fried Noodles,
no meat“, die andere „Mixed Vegetables, no meat“. Um Barbara nicht nur
köstliches Gemüse anzutun, bestellen wir „some rice“. Nach
verständnisvollem Nicken des Kellners kredenzt er uns ein Glas Bier vom Fass
aus der Kneipe nebenan. Wir sind also durchschaut und unsere
wirklich wichtigen Bedürfnisse jenseits des Hungers bekannt. Unter ausgedehntem Schmunzeln
wird Barbara schließlich doch noch eine Schüssel Reis gereicht. Und beim
Bezahlen am Biertresen greift der Barkeeper unaufgefordert hinter sich
in die Apotheke. Schön, bedeutende Wünsche von den Augen
abgelesen zu bekommen. Den Namen dieser Kneipe möchtet Ihr gerne erfahren?
Tut uns leid, können wir noch immer nicht lesen …
Ach
ja, …
Kultur gibt's hier
ja auch noch - in Form der Höhlen von
.jpg) Hpo
Win Taung. Per „Special Boat“, das als
ordinary boat Einheimische über den
Chindwin
transportiert, für einen deutlich niedrigeren Preis allerdings, gelangen wir
ans andere Ufer nach Nyaung Bin. Für 2.500 K$ sind wir die einzigen an Bord
und deutlich schneller als das local boat gleicher Bauart … Hpo
Win Taung. Per „Special Boat“, das als
ordinary boat Einheimische über den
Chindwin
transportiert, für einen deutlich niedrigeren Preis allerdings, gelangen wir
ans andere Ufer nach Nyaung Bin. Für 2.500 K$ sind wir die einzigen an Bord
und deutlich schneller als das local boat gleicher Bauart …
Dort im Westen werden wir in gutem Englisch korrekt aufgeklärt:
„Limousine, Taxi, Pickup or Jeep to Minzu same price!“ Also lassen wir
uns im Geländewagen zu den Höhlen kutschieren, die vor über sechshundert
Jahren in den Sandsstein geschlagen wurden. Das einspurige Teerband
erspart uns all zu viel Staub.
Im Eingangsbereich warten Affen und Ticketverkäuferin – lediglich letztere erhält eine kleine
Aufmerksamkeit. Mit einem aufgeweckten, leidlich Englisch sprechenden
jungen Guide arbeiten wir uns durch die Nischen, Kavernen, Grotten, die
sämtlich durch schmale und niedrige Eingänge zu betreten sind, sich dann
oft.jpg) großzügig erweitern, um Buddhastatuen in allen Positionen zu
beherbergen: Aus dem gleichen Stein, vor
Ort in der
selben Höhle gemeißelt hocken, sitzen, stehen oder liegen sie, oft
umrankt von filigranen Wand- und Deckenmalereien. Da unser „Buddhacaveerklärer“
deutlich mehr zu deuten weiß als das „orange book“, sind wir gerne
bereit, ihm heimlich in einer Nische, durch Buddha verdeckt, ein paar
Scheine zuzustecken, die er vor der örtlichen Andenkenmafia verbergen
kann, bevor er offiziell sein Salär kassiert, welches er mit wem auch
immer teilen muss.
großzügig erweitern, um Buddhastatuen in allen Positionen zu
beherbergen: Aus dem gleichen Stein, vor
Ort in der
selben Höhle gemeißelt hocken, sitzen, stehen oder liegen sie, oft
umrankt von filigranen Wand- und Deckenmalereien. Da unser „Buddhacaveerklärer“
deutlich mehr zu deuten weiß als das „orange book“, sind wir gerne
bereit, ihm heimlich in einer Nische, durch Buddha verdeckt, ein paar
Scheine zuzustecken, die er vor der örtlichen Andenkenmafia verbergen
kann, bevor er offiziell sein Salär kassiert, welches er mit wem auch
immer teilen muss.
.jpg) Fast
zurück am Fähranleger treffen wir auf einen Umzug anlässlich einer
Novizenfeier. Die herausgeputzten Frauen und Kinder freuen sich über
uns als Zuschauer mindestens ebenso wie wir über ihre farbenfrohe
Erscheinung, winken und lächeln uns zu und lassen sich bereitwillig
fotografieren. Das uns am Ufer zugerufene „See you next year!“ fassen
wir als Kompliment auf, auch wenn andere Ziele locken ... Fast
zurück am Fähranleger treffen wir auf einen Umzug anlässlich einer
Novizenfeier. Die herausgeputzten Frauen und Kinder freuen sich über
uns als Zuschauer mindestens ebenso wie wir über ihre farbenfrohe
Erscheinung, winken und lächeln uns zu und lassen sich bereitwillig
fotografieren. Das uns am Ufer zugerufene „See you next year!“ fassen
wir als Kompliment auf, auch wenn andere Ziele locken ...
(Fotos vom
Ausflug nach Hpo Win Taung)
Nichts ist so schlimm, ...
dass es nicht für etwas gut wäre: Dank des
um acht Stunden auf den Nachmittag verlegten Abflugs von Yangon nach
Siem Reap - des neuen Visums wegen, Ihr erinnert Euch - verbleibt
reichlich Zeit nach den Dateien auf dem Rechner zu spüren, welche
plötzlich samt und sonders unauffindbar verschwunden waren. Johannes,
gleichfalls Gast im Motherland und Experte, entdeckt sie alle nach
trickreichem Suchen an Orten, wo sie nicht hingehören, rettet Willis
bisherige Arbeit, sämtliche Fotos und lässt eine Fortsetzung der website
wahrscheinlicher werden. Nochmals ganz herzlichen Dank nach Freiburg!!!
Gute Entscheidung, ...
nach
Siem Reap zu gehen, um sich zu erholen. Die nähere Umgebung der "Pub
Street", der alte und auch der neue Nachtmarkt sind nach wie vor ein Touristenbums, allerdings finden sich abseits dieser Ameisenhaufen, vor
allem an dem Ufer des Siem Reap River, durchaus ruhige Fleckchen. Andere
Oasen als das FCC haben wir zwar noch nicht entdeckt, doch ist auch unser
guesthouse, Bayon Garden, ein Wohlfühlort: ausgesprochen heimelige Zimmer,
in denen auch die "kleinen Dinge" stimmen, und, mit Tanja und Frank,
richtig liebe landlords, die unsere Wünsche ahnen, bevor sie aus unserem
Unterbewusstsein auftauchen.
(unsere Reiseroute vom 4.
Februar bis 7. März -
dritte Etappe)
Luftveränderung …
auf 1.100 m Höhe nach fast zehn Wochen im Tiefland
hat schon etwas: mildes
.jpg) Klima,
erträgliche Temperaturen, (fast) saubere Luft und jede Menge Grün fürs
Auge. Gut nachvollziehbar, warum einst die Briten hier in ihrer „Hill
Station“ an der Burma Road Schutz vor der feuchten Hitze Rangons und
Mandalays suchten. Klima,
erträgliche Temperaturen, (fast) saubere Luft und jede Menge Grün fürs
Auge. Gut nachvollziehbar, warum einst die Briten hier in ihrer „Hill
Station“ an der Burma Road Schutz vor der feuchten Hitze Rangons und
Mandalays suchten.
Bevor wir jedoch die Annehmlichkeiten von
Pyin Oo Lwin in den
Shanbergen genießen können, liegen knapp anderthalb Stunden holperiger,
kurvenreicher, stetig ansteigender Strecke hinter uns, deren Folgen und
Nebenwirkungen nicht mit nur einem Raki abgetan sind, Angela:
Mindestens eine mittlere Alkoholvergiftung scheint angezeigt, drischt
unser Heizer doch einen Reifen, der ihn bis zu unserer unversehrten
Ankunft vor dem guesthouse dem Verdacht aussetzt,
Reinkarnations(ver)helfer welcher buddhistischen Schule auch immer zu
sein …
Die Uhren in diesem
Provinzstädtchen, selbst die im Purcell
Tower, ticken einmal.jpg) mehr langsamer als in den Großstädten, vor allem ein wenig abseits der
Hauptstraße. Statt der Kicks in Gigs gibt’s welche in Gharrys, jenen
vierrädrigen „Postkutschen light“, welche die wichtigsten
Transportmittel des hiesigen ÖPNV ausmachen. Und die sind gut so: keine
blockierenden Türen, keine versagenden Bremsen, keine eingefrorenen
Weichen – dazu per se zuvorkommendes, freundliches Personal, dem
berliner Kotterigkeit nicht erst für teuer (west-deutsches Steuer-) Geld
ausgetrieben werden muss …
mehr langsamer als in den Großstädten, vor allem ein wenig abseits der
Hauptstraße. Statt der Kicks in Gigs gibt’s welche in Gharrys, jenen
vierrädrigen „Postkutschen light“, welche die wichtigsten
Transportmittel des hiesigen ÖPNV ausmachen. Und die sind gut so: keine
blockierenden Türen, keine versagenden Bremsen, keine eingefrorenen
Weichen – dazu per se zuvorkommendes, freundliches Personal, dem
berliner Kotterigkeit nicht erst für teuer (west-deutsches Steuer-) Geld
ausgetrieben werden muss …
Die
Einheimischen, ein ethnischer Mix fast aller Volksgruppen vom östlichen
Indien bis zum südwestlichen China und einer entsprechenden Vielfalt an
.jpg) Glaubensgemeinschaften,
unter denen unserer Beobachtung nach lediglich animistische fehlen, sind
etwas zurückhaltend, können allerdings ein Lächeln nicht unerwidert
lassen. Glaubensgemeinschaften,
unter denen unserer Beobachtung nach lediglich animistische fehlen, sind
etwas zurückhaltend, können allerdings ein Lächeln nicht unerwidert
lassen.
Obwohl (oder
gerade weil?) der Ort keinen ärmlichen, sondern eher einen wohlhabenden
Eindruck macht, trifft mensch auf bettelnde Kinder, vom Krabbel- bis zum Grundschulalter, die noch vor „Mama“ oder „Papa“ Englisch gelernt
haben: “Money???“ Auch wenn die Bettelei gut organisiert wirkt, es sind
diesmal keine Bangladeshi, die einem die ausgestreckte Hand entgegen halten …
(Fotos aus der
Hill Station)
"Very interesting, Sir!" ...
ist das Prädikat,
das Arun, einer unserer Motojungs nepalesischer Herkunft
.jpg) jedem wie auch immer gemauerten Steinhaufen zukommen lässt, um unsere
Aufmerksamkeit auf Gebäude mit kolonialistischem Flair, gülden getünchte Stupas, oder andere Bauwerke zu richten, die vom "orange book"
bis zum "planet" geflissentlich (und zu Recht) ignoriert werden.
jedem wie auch immer gemauerten Steinhaufen zukommen lässt, um unsere
Aufmerksamkeit auf Gebäude mit kolonialistischem Flair, gülden getünchte Stupas, oder andere Bauwerke zu richten, die vom "orange book"
bis zum "planet" geflissentlich (und zu Recht) ignoriert werden.
Nach dem Besuch
einer Schule, in welcher blinde Kinder bis zur Hochschulreife geführt
werden sollen - allein ein Hauch Bildung und die garantierte tägliche
Versorgung mit Nahrung, in einem Landstrich, in dem jegliche
körperliche Behinderung als Strafe für Verfehlungen während eines
früheren Lebens geächtet wird, ist schon eine Spende wert - stehen
wir vor einer Pagode, die unser guide als "very powerfull, Sir,
donation good!" hervorhebt. Glasvitrinen voller Geldscheine fürs good kharma; am Fuße des Berges hoffen die Blinden auf den ersten Computer.
Ja, ja, ich hör schon auf und schreib auch nicht weiter, welche Messer
mir in der Tasche auf gehen. Ich reise schließlich als "foreigner" in ihrem
Land
... Sollen sie zum Vollmond im November doch ihre aufwändig und
für teuer Geld gebauten Ballons steigen lassen - "de Zooch kütt" gibt's
auch nicht für umsonst und Ausgaben für Benny XVIth's Sessions für seine
Fans (nicht nur in
Rom) ließen sich für
ernsthaft Notleidende und Bedürftige gewiss nachhaltiger anlegen ...
.jpg) Die
"small waterfalls", Pwe Kauk, erlaufen wir uns noch alleine: Hier können wir uns schließlich nicht verirren. Beim fast einstündigen
Abstieg zu "the big falls", den Anisakan Fällen, vertraut man uns drei
Schutzengeln an, deren Job noch lange nicht erledigt ist, nachdem sie
uns sicher zur Talsohle geführt und uns eine Cola verkauft haben: Sie
fächeln uns beim Aufstieg frische Luft zu, verhindern telepathisch jeden
(füßischen) Fehltritt und bringen uns sicher an unseren Ausgangsort
zurück. Zweieinhalb Stunden zu dritt in der Hoffnung, dass some small
money abfällt - auch hier verschieben sich Dimensionen ... Die
"small waterfalls", Pwe Kauk, erlaufen wir uns noch alleine: Hier können wir uns schließlich nicht verirren. Beim fast einstündigen
Abstieg zu "the big falls", den Anisakan Fällen, vertraut man uns drei
Schutzengeln an, deren Job noch lange nicht erledigt ist, nachdem sie
uns sicher zur Talsohle geführt und uns eine Cola verkauft haben: Sie
fächeln uns beim Aufstieg frische Luft zu, verhindern telepathisch jeden
(füßischen) Fehltritt und bringen uns sicher an unseren Ausgangsort
zurück. Zweieinhalb Stunden zu dritt in der Hoffnung, dass some small
money abfällt - auch hier verschieben sich Dimensionen ...
(Fotos vom
Motoausflug)
Vor
der Entdeckung der Langsamkeit …
bleibt mensch während der Bahnfahrt von Pyin Oo
Lwin nach Hsipaw nicht.jpg) verschont. Sie beginnt bereits in aller Früh am Fahrkartenschalter,
der zwar offen, doch nicht geöffnet ist. Ein Umweg für „foreigners“ führt
später über den Bahnsteig durch ein Hintertürchen zu einem verkürzten
Verfahren, welches allerdings ob des akribischen Notierens vieler Daten aus dem Reisepass ein wenig länger dauert: Hier werden gegen U$
die Tickets für Touris verkauft. Allerdings sind jene für die „upper
class“ erst mit Einfahrt des Zuges zu haben: Die noch freien der (wie im
ICE) nummerierten Plätze werden an Ort und Stelle ermittelt, damit es zu
keinen Buchungspannen kommt (wie beim ICE). Wesentlich unpünktlicher als
das Flaggschiff der Deutschen Bahn ist unser „Train Up“ mit einer
halben Stunde Verspätung auch nicht.
verschont. Sie beginnt bereits in aller Früh am Fahrkartenschalter,
der zwar offen, doch nicht geöffnet ist. Ein Umweg für „foreigners“ führt
später über den Bahnsteig durch ein Hintertürchen zu einem verkürzten
Verfahren, welches allerdings ob des akribischen Notierens vieler Daten aus dem Reisepass ein wenig länger dauert: Hier werden gegen U$
die Tickets für Touris verkauft. Allerdings sind jene für die „upper
class“ erst mit Einfahrt des Zuges zu haben: Die noch freien der (wie im
ICE) nummerierten Plätze werden an Ort und Stelle ermittelt, damit es zu
keinen Buchungspannen kommt (wie beim ICE). Wesentlich unpünktlicher als
das Flaggschiff der Deutschen Bahn ist unser „Train Up“ mit einer
halben Stunde Verspätung auch nicht.
Kaum hat sich der „Up“ durch einen langen Heulton angekündigt, strömen
aus allen Richtungen Frauen herbei, die auf ihren Köpfe große Bleche und
riesige Körbe voller schmackhafter Köstlichkeiten anbieten, um die seit
vier Stunden darbenden Reisenden aus Mandalay am Verhungern und
Verdursten zu hindern.
.jpg) Wichtiger
als das Einhalten der Abfahrtszeiten scheint das Einhalten der
Haltezeit. Pünktlich nach einer guten halben Stunde ruckelt der Zug an.
Je nachdem, ob er über die nicht verschweißten Schienen up oder down
rumpelt, nimmt er an Fahrt und Geschaukel ab oder – zu … Wichtiger
als das Einhalten der Abfahrtszeiten scheint das Einhalten der
Haltezeit. Pünktlich nach einer guten halben Stunde ruckelt der Zug an.
Je nachdem, ob er über die nicht verschweißten Schienen up oder down
rumpelt, nimmt er an Fahrt und Geschaukel ab oder – zu …
Unser Großraumabteil ist gut zur Hälfe besetzt;
Fremde und Einheimische halten sich die Waage. Die Polster (grün fürs
Auge) sind abgewetzt und durchgesessen, die Fenster seit der Jungfernfahrt
nicht mehr geputzt, die Wände angeschmuddelt und die Flecken auf dem Boden erzählen Geschichten.
Doch sonst ist’s recht gemütlich – viel Beinfreiheit, frische Luft ob
offener Türen und nicht zu schließender Fenster,
nette Aussicht, angenehme Mitreisende.
Auf
den Hügeln und in den Ebenen werden Gerste, Bohnen, Erbsen, Zuckerrohr,
Gemüse, Erdbeeren und Erdnüsse angebaut. Die Dörfer wirken aufgeräumt,
nicht unbedingt besonders wohlhabend, doch keinesfalls ärmlich. In den
Kleinstädten, die wir durchfahren wird baulich ein wenig mehr geprotzt.
Bei jedem Halt rauscht die Reizüberflutung an Essbarem persönlich
vorbei. Hin und wieder verweilt auch eine Gruppe Schülerinnen (die sind,
wie bei uns, wohl fleißiger als Jungs) im Abteil, um ihre
Englischkenntnisse an den „foreigner“ zu bringen. Ein schriller Pfiff
kündigt die Weiterfahrt an und leert den Mittelgang.
Der
Gokteik Viadukt
beeindruckt als Stahlkonstruktion, die sich
gut 800 m lang über einen Fluss spannt und den Weg nach China erheblich
verkürzt. Nach reichlich sechs Stunden Langsamkeit erreichen wir
schließlich Hsipaw.
(Fotos von der
Bahnfahrt)
(... und vom
Viadukt)
(Paul Theroux zu seiner
Zugreise über den Viadukt)
(... und paar
Hinweise auf Sehenswürdigkeiten)
Die
Burma Road
…
führt mitten durch den kleinen Ort, in dem mensch
„umgeben ist von Hügeln,.jpg) Wäldern und freundlich zurückhaltenden Bergbewohnern“ ( lt. Loose),
allerdings auch vom Diesel, den die unzähligen LKWs in die Straßen
blasen. Durch
Hsi-paw flutet alles an Menschen und Waren, was von China
kommend auf den Weg nach Mandalay geschickt wird. Eine besondere
Dröhnung verabreichen die zahlreichen Schwertransporter, welche
Stahlröhren anliefern für die Gaspipeline, die als
China-Myanmar-Pipelines-Project
über viele Kilometer an der Bahnlinie entlang
geschweißt wird. So richtig in Bann gezogen, wie Loose es gerne hätte,
wird " der Traveller" mithin nicht, zumindest nicht auf Anhieb ...
Wäldern und freundlich zurückhaltenden Bergbewohnern“ ( lt. Loose),
allerdings auch vom Diesel, den die unzähligen LKWs in die Straßen
blasen. Durch
Hsi-paw flutet alles an Menschen und Waren, was von China
kommend auf den Weg nach Mandalay geschickt wird. Eine besondere
Dröhnung verabreichen die zahlreichen Schwertransporter, welche
Stahlröhren anliefern für die Gaspipeline, die als
China-Myanmar-Pipelines-Project
über viele Kilometer an der Bahnlinie entlang
geschweißt wird. So richtig in Bann gezogen, wie Loose es gerne hätte,
wird " der Traveller" mithin nicht, zumindest nicht auf Anhieb ...
Ein
wenig Charme hat sich der Flecken allerdings in seinen Seitenstraßen bewahrt. Um
die vielen Marktstände herum herrscht das übliche bunte Treiben, alle möglichen Handwerker
arbeiten draußen vor der Tür und in kleinen Werkstätten werden
.jpg) Blusen
mit Perlen bestickt, Cheroots gerollt oder Reisnudeln aufs
Trockengestell gehängt. Und
unten am Fluss findet sich im Black House Coffee Shop zwar kein guter Kaffee,
doch eine herrliche Oase der Ruhe mit Aussicht über den Dothawady, in
dessen Fluten sich spät nachmittags nach der Arbeit auf dem Feld Mensch und Wasserbüffel aalen. Und Bier gibt's
dort auch - ein wichtiger Grund, sich nicht auf Wandertour zu begeben,
zumal die trockene Landschaft mit ihren abgeernteten Reisfeldern nicht unbedingt dazu verlockt. Verschieben wir
eben auf Kalaw und Pindaya
... Blusen
mit Perlen bestickt, Cheroots gerollt oder Reisnudeln aufs
Trockengestell gehängt. Und
unten am Fluss findet sich im Black House Coffee Shop zwar kein guter Kaffee,
doch eine herrliche Oase der Ruhe mit Aussicht über den Dothawady, in
dessen Fluten sich spät nachmittags nach der Arbeit auf dem Feld Mensch und Wasserbüffel aalen. Und Bier gibt's
dort auch - ein wichtiger Grund, sich nicht auf Wandertour zu begeben,
zumal die trockene Landschaft mit ihren abgeernteten Reisfeldern nicht unbedingt dazu verlockt. Verschieben wir
eben auf Kalaw und Pindaya
...
(alte "Nebensächlichkeiten"
aufgewärmt)
(Greg Adams:
Burma Road)
(Fotos
aus dem Ort)
(... und
vor der Rückfahrt)
Ein
wenig Erholung …
ist
nach der Anreise aus der weiten Ebene um Mandalay in den ehemaligen
britischen Luftkurort durchaus angezeigt, auch wenn wir die fast 1.300m.jpg) Höhenunterschied nicht per pedes überwunden, sondern uns im share taxi
hinaufgeschraubt haben: Das oft recht schmale Sträßchen windet sich
über viele Kilometer als einspurige Großbaustelle in unzähligen
Serpentinen die westlichen Shanberge hinauf, verpasst dem Reisenden
jede Menge Staub und lässt ihn ob der Fahrweise des Chauffeurs und der
entgegen kommenden LKWs hin und wieder den lieben Gott anrufen, an den
er schon lange nicht mehr glaubt …
Höhenunterschied nicht per pedes überwunden, sondern uns im share taxi
hinaufgeschraubt haben: Das oft recht schmale Sträßchen windet sich
über viele Kilometer als einspurige Großbaustelle in unzähligen
Serpentinen die westlichen Shanberge hinauf, verpasst dem Reisenden
jede Menge Staub und lässt ihn ob der Fahrweise des Chauffeurs und der
entgegen kommenden LKWs hin und wieder den lieben Gott anrufen, an den
er schon lange nicht mehr glaubt …
Die intensiv betriebene Landwirtschaft in der
Zentralebene wird vor allem durch eines bewegt: Muskelkraft – von Mensch
und Tier. Ochsengespanne begegnen einer so häufig wie Mopeds in
Mandalay, auch vor dem klassischen Hakenpflug oder der durch Kinder
beschwerten Egge trotten Zebus. Und alles, was Menschin stemmen kann,
wird auch durch sie von A nach B transportiert – und darüber hinaus …
An
den Berghängen lösen Gerste, Kartoffeln, Zwiebeln, Blumenkohl, Salat,
Chili und andere „Suppenkräuter“ die „Früchte des Feldes“ aus dem
Tiefland ab (Mais, Reis, Baumwolle, Gemüse, Sesam). Die Häuser sind aus
Holz gebaut, die Siedlungen wirken weniger wohlhabend. Die Kinder
tragen hier allerdings Gummistiefel, keine Latschen mehr …
Nach den Schlaglöchern und den Spitzkehren im
Nirgendwo taucht dann endlich
Kalaw
auf: Etwas kühler (auch temperaturmäßig), mit
einigen Reminiszenzen
.jpg) britischer
Kolonialarchitektur und einem bemerkenswerten Querschnitt durch alle
möglichen Ethnien, die gerade heute, zum „Fünftagemarkt“, die Gassen
füllen. Da wir, auf der Ameisenstraße des Tourismus, lediglich eine Volksgruppe unter vielen darstellen, fallen wir nicht weiter auf,
werden also genau so behandelt – und das ist gut so!!! britischer
Kolonialarchitektur und einem bemerkenswerten Querschnitt durch alle
möglichen Ethnien, die gerade heute, zum „Fünftagemarkt“, die Gassen
füllen. Da wir, auf der Ameisenstraße des Tourismus, lediglich eine Volksgruppe unter vielen darstellen, fallen wir nicht weiter auf,
werden also genau so behandelt – und das ist gut so!!!
Die zahlreichen Gesichter im
Markttreiben sind
offen, uns zugewandt, lassen sich auf’s halbherzige Feilschen ein,
freuen sich über hellhäutige, bärtige, grauhaarige Abwechslung und
bedeuten uns ein derartig herzliches Willkommen, dass Menschin die
gewechselten Worte gar nicht mehr verstehen muss. Diesen Ort, obwohl
alles andere als vom Tourismus verschont, schließen wir heute auf
Anhieb ins Herz!
Mal
sehen, was uns Morgen bringt …
(Infos zur
Volksgruppe der Shan)
(Infos zum
Shan State)
(... und
Hinweise zu Sehenswertem ...)
(Fotos
aus
dem Ort)
(Gesichter
vom Fünf-Tage-Markt)
…
na gut, die Realität zurück: Die Menschen bleiben liebenswert. Der Ort hingegen wirkt außerhalb des alle fünf Tage stattfindenden Marktes,
welcher
die Bewohner der umliegenden Weiler sowohl als Händler wie als Käufer
anzieht, derart was von verschlafen, dass es uns einmal mehr in Pagoden
und zu Bambus-Buddhas treibt. Wird also Zeit, endlich mal wieder etwas
Richtiges zu unternehmen …
Unterwegs mit Mr. Charles …
durch verschiedene Dörfer der
Palaung
und
Daung
wird allein schon dadurch zum.jpg) Erlebnis, dass unser Guide (in unserem Alter) nicht nur jeden Pfad und
jeden Gartenzaun kennt, sondern auch all diejenigen, die ihn benutzen
bzw. dahinter leben. So erfahren wir nicht nur Näheres über die Sitten
und Gebräuche der jeweiligen Ethnien, sondern auch einiges über Lieb und
Leid der Familien, von denen wir „auf einen Tee“ in ihre oft
bescheidenen Behausungen gebeten werden. Ihr Interesse an uns, unserer
Familie und unserem Leben ist mindestens so groß wie umgekehrt und wird
ohne Scheu formuliert.
Erlebnis, dass unser Guide (in unserem Alter) nicht nur jeden Pfad und
jeden Gartenzaun kennt, sondern auch all diejenigen, die ihn benutzen
bzw. dahinter leben. So erfahren wir nicht nur Näheres über die Sitten
und Gebräuche der jeweiligen Ethnien, sondern auch einiges über Lieb und
Leid der Familien, von denen wir „auf einen Tee“ in ihre oft
bescheidenen Behausungen gebeten werden. Ihr Interesse an uns, unserer
Familie und unserem Leben ist mindestens so groß wie umgekehrt und wird
ohne Scheu formuliert.
Ebenso unbedarft erzählen sie von sich, von ihren
Freuden und Nöten, bevorstehenden Hochzeiten und enttäuschenden
Verbindungen einiger ihrer Töchter mit „Birmesen“. Palaung dürfen nur
Angehörige ihrer Volksgruppe, die in der Umgebung von Kalaw auf neun
Dörfern verteilt lebt, ehelichen – ansonsten müssen sie ihre Siedlung
verlassen. Lediglich an den beiden höchsten Feiertagen im Jahr ist es
ihnen gestattet, ihre elterliche Familie über Tag zu besuchen …
Da
ihre traditionelle Kleidung aufwändig herzustellen und somit recht teuer
ist, tragen jüngere Menschen ihre Trachten nur an Feiertagen. Jeans und
T-Shirts sind sowieso cooler …
.jpg) Die
Männer sitzen während der Trockenzeit einmal mehr genüsslich faulenzend zu Hause herum, weil nur wenig auf den Feldern zu arbeiten
ist. Sie flicken ein wenig an der Hütte herum oder bekochen ihre Familien. Die
Frauen hingegen stellen Besen her, ernten in den Steilhängen Teeblätter
oder sammeln Holz – eine Knochenarbeit, eher was für Männer … Die
Männer sitzen während der Trockenzeit einmal mehr genüsslich faulenzend zu Hause herum, weil nur wenig auf den Feldern zu arbeiten
ist. Sie flicken ein wenig an der Hütte herum oder bekochen ihre Familien. Die
Frauen hingegen stellen Besen her, ernten in den Steilhängen Teeblätter
oder sammeln Holz – eine Knochenarbeit, eher was für Männer …
Weben per Hand gehört „selbstverständlich“ zu den Frauenarbeiten, wird
uns auch immer wieder vorgeführt, obgleich die meisten der zum Verkauf
angebotenen Produkte offen-sichtlich maschinell erstellt worden sind.
Gut, dass keine der Ladies darauf besteht, dass wir eine ihrer
"handgefertigten“ Waren erwerben. "When you see it, they are dream
catchers. At your home they will be dust catchers" meint Mr. Charles
dazu ...
Die
Webvorrichtung teilt sich das Erdgeschoss mit der offenen Kochstelle,
die Fliegen fern hält und einen ungetrübten Blick unmöglich macht.
Tränen in die Augen treibt es uns auch, wenn wir mit Maßstäben der
Kaiserstraße auf die.jpg) Einrichtung der „Wohnung“ blicken: Als Kleiderschrank biegt sich eine
Bambusstange von Wand zu Wand, auf der die Alltagskleidung von der
Winterjacke bis zum T-Shirt und darunter hängen. Ihr wächst die
Vorratskammer (der Jahresbedarf an Reis, in Säcken gestapelt) vom
Holzfußboden aus entgegen. Oberhalb der Feuerstelle schwebt ein
Gestell, auf dem Gemüse, Obst, Fisch etc. gedörrt, Fleisch und
Teeblätter getrocknet und all die Dinge aufbewahrt werden, die keine
Feuchtigkeit abkönnen, doch wärmebeständig sind. In Griffnähe stehen
Kochtöpfe und Kasserollen aller Größen. Das Geschirr ist auf dem einzigen
wahrnehmbaren Regalbrett gestapelt. Schneidewerkzeuge und Besteck,
Essstäbchen eingeschlossen, finden Platz in einem Bierglas (0,5 l).
Hygieneartikel füllen das zweite Bierglas, welches neben einem
Wasserkanister zu finden ist. An den Wänden verteilt, oft an Pfosten
verkantet, lehnt Werkzeug, vom Sägeblatt bis zur Spitzhacke. Da, wo
Einrichtung der „Wohnung“ blicken: Als Kleiderschrank biegt sich eine
Bambusstange von Wand zu Wand, auf der die Alltagskleidung von der
Winterjacke bis zum T-Shirt und darunter hängen. Ihr wächst die
Vorratskammer (der Jahresbedarf an Reis, in Säcken gestapelt) vom
Holzfußboden aus entgegen. Oberhalb der Feuerstelle schwebt ein
Gestell, auf dem Gemüse, Obst, Fisch etc. gedörrt, Fleisch und
Teeblätter getrocknet und all die Dinge aufbewahrt werden, die keine
Feuchtigkeit abkönnen, doch wärmebeständig sind. In Griffnähe stehen
Kochtöpfe und Kasserollen aller Größen. Das Geschirr ist auf dem einzigen
wahrnehmbaren Regalbrett gestapelt. Schneidewerkzeuge und Besteck,
Essstäbchen eingeschlossen, finden Platz in einem Bierglas (0,5 l).
Hygieneartikel füllen das zweite Bierglas, welches neben einem
Wasserkanister zu finden ist. An den Wänden verteilt, oft an Pfosten
verkantet, lehnt Werkzeug, vom Sägeblatt bis zur Spitzhacke. Da, wo
.jpg) wir
gerade sitzen, wird abends eine zusätzliche Bambusmatte ausgerollt –
das Bett. Und dabei ist die Familie, bei der wir gerade Tee trinken und
Bananen essen, keineswegs ärmlich, im Gegenteil: „They just think
different about things they really need and like …“ wir
gerade sitzen, wird abends eine zusätzliche Bambusmatte ausgerollt –
das Bett. Und dabei ist die Familie, bei der wir gerade Tee trinken und
Bananen essen, keineswegs ärmlich, im Gegenteil: „They just think
different about things they really need and like …“
Hiking mit U Charles setzt einem eine ganze Menge
Haken ins Hirn! U ist übrigens die birmesische Anrede für uns Männer ü
60 - U Felix, U Siggi, U Bernhard, U Jürgen, U Ndsoweiter.
(Fotos von
den
Wanderungen)
(unsere
Wanderroute auf Google Earth)
Na
ja, Pindaya -
…
kann ja eher wenig dafür, dass es eine für Myanmar weitere mit
Buddhafiguren.jpg) vollgepfropfte Tropfsteinhöhle aufzuweisen hat und damit Anhänger jener Weltanschauung selbst aus dem fernen Italien anzieht: „Che Buddha
illumine il gruppo di Gubbio.“ Hat er hoffentlich. Wir hingegen stellen
auch nach dem Besuch der berühmten Pilgerstätte unverfroren unsere
transzendentale Erleuchtungsresistenz fest und finden olle Kalles
Bemerkung zum "Opium des Volkes" einmal mehr bestätigt ...
vollgepfropfte Tropfsteinhöhle aufzuweisen hat und damit Anhänger jener Weltanschauung selbst aus dem fernen Italien anzieht: „Che Buddha
illumine il gruppo di Gubbio.“ Hat er hoffentlich. Wir hingegen stellen
auch nach dem Besuch der berühmten Pilgerstätte unverfroren unsere
transzendentale Erleuchtungsresistenz fest und finden olle Kalles
Bemerkung zum "Opium des Volkes" einmal mehr bestätigt ...
Der
Blick auf die Landschaft allerdings lohnt die unzähligen Stufen.
Vermutlich deshalb sind die Höhlen auch ein „beliebter Wallfahrtsort für
viele Birmanen aus der Zentralebene“ – hier gibt’s wenigstens Gegend zu
sehen.
Und die beginnt bereits hinter
Auban mit sanften
Hügeln, einzelnen Baumgruppen und frisch bestellten Äckern – ein
Stückchen Voralpenland mit Blick auf steile Höhenzüge am Horizont, wären
da nicht die zahlreichen Pagoden, die einem weiß oder gülden entgegen
leuchten ...
Das
Städtchen
ist mindestens so verschlafen wie im Loose
beschrieben; die Einwohner begegnen uns „foreignern“ zwischen
freundlich grüßend bis ungestört
.jpg) ihrer
Wege gehend. Viele davon führen zum künstlichen See mit seinen
zahlreichen Waschplätzen. Die Erfindung der Waschmaschine hat bei uns
zur Zerstörung wichtiger Kommunikationszentren und –möglichkeiten
geführt, die kein Chatroom ersetzen kann: Männlein wie Weiblein waschen
gemeinsam unter regem Geplausche jeweils ihre eigene schmutzige Wäsche
und dann sich selbst – beides scheint allen Beteiligten sehr zu
gefallen. Schön für sie - was bleibt uns also anderes übrig, als Höhlen
und Teakholzklöster aufzusuchen … ihrer
Wege gehend. Viele davon führen zum künstlichen See mit seinen
zahlreichen Waschplätzen. Die Erfindung der Waschmaschine hat bei uns
zur Zerstörung wichtiger Kommunikationszentren und –möglichkeiten
geführt, die kein Chatroom ersetzen kann: Männlein wie Weiblein waschen
gemeinsam unter regem Geplausche jeweils ihre eigene schmutzige Wäsche
und dann sich selbst – beides scheint allen Beteiligten sehr zu
gefallen. Schön für sie - was bleibt uns also anderes übrig, als Höhlen
und Teakholzklöster aufzusuchen …
(Verschlafenes
aus dem Ort)
Leben ins Dorf …
bringt der Fünftagemarkt, der pünktlich zum
Rosenmontag jede Menge Volk.jpg) herbei ruft. Bereits gegen Fünfe in der
Früh ist unsere Unterkunft umlagert von
Kohlköpfen, Zwiebeln, Knofel und deren Verkäuferinnen: Die Bauern aus
der näheren Umgebung bieten all die Feldfrüchte feil, die auch während
der übrigen Tagen an festen Marktständen zu erstehen sind, heute jedoch
in Großhandelsmengen
direkt vom Erzeuger - und somit frisch.
herbei ruft. Bereits gegen Fünfe in der
Früh ist unsere Unterkunft umlagert von
Kohlköpfen, Zwiebeln, Knofel und deren Verkäuferinnen: Die Bauern aus
der näheren Umgebung bieten all die Feldfrüchte feil, die auch während
der übrigen Tagen an festen Marktständen zu erstehen sind, heute jedoch
in Großhandelsmengen
direkt vom Erzeuger - und somit frisch.
Andererseits decken sich die Angehörigen der „hill tribes“ mit all der
„Hardware“ ein, die ihnen kein fliegender Händler in ihre Bergdörfer
bringt: Plastikschüsseln, Kunststoffrohre, Wellblech fürs Dach,
Bambusmatten.
Auch wenn bereits gegen Mittag die Ersten den Flecken schwer beladen
Richtung
.jpg) heimatlicher
Siedlung verlassen, das Gewusel hält bis zum frühen Abend an. Die
letzten mobilen Stände sind jedoch noch nicht abgebaut, einige Trecker
und Pick-ups werden noch mit den wenigen unverkauften Kohlköpfen und neu
erworbenen Gütern beladen, schon lässt Dornröschen für die nächsten
vier Tage herzlich grüßen – Zeit, sich auf die Suche nach neuen Gestaden
zu begeben … heimatlicher
Siedlung verlassen, das Gewusel hält bis zum frühen Abend an. Die
letzten mobilen Stände sind jedoch noch nicht abgebaut, einige Trecker
und Pick-ups werden noch mit den wenigen unverkauften Kohlköpfen und neu
erworbenen Gütern beladen, schon lässt Dornröschen für die nächsten
vier Tage herzlich grüßen – Zeit, sich auf die Suche nach neuen Gestaden
zu begeben …
(Eindrücke
vom Fünftagemarkt - für Geduldige...)
Zu
neuen Gestaden …
geleitet uns Mr. Charles. Mit Wäsche zum Wechseln,
einer warmen Jacke für die kühlen Nächte, etwas Wasser (auf 1200 m ist
Malaria kaum mehr verbreitet) und einer Notration Nüsse im Rucksack
brechen wir von Kalaw auf – und höhenmetern uns über Pfade und staubige
Pisten bis Lut Pyin, einem Dorf der Taung
Yoe, in.jpg) dem wir zu Mittag speisen.
dem wir zu Mittag speisen.
Unser Koch zaubert in der Küche unserer
Gastfamilie ein Viergängemenue vom Feinsten – zubereitet aus all dem
frischen Gemüse und Obst, welches er heute früh auf dem Fünftagemarkt erstanden hat. Nach dem Mahl gesellen sich einige Freundinnen unserer
75jährigen Hausherrin dazu und freuen sich mit ihr, mehr über uns und
unsere Familie zu erfahren. Selbst erzählen sie sehr freimütig über
sich und die Ihren.
Ebenso wie unterwegs begegnen wir auch im Dorf freundlich grüßenden
Einheimischen, die, kaum dass Mr. Charles einen Plausch begonnen hat,
unverhohlen und unverstellt alles Mögliche von und über uns wissen
wollen. Wir hören dafür mehr über die aktuellen Preise für Reis, warum
es sich endlich lohnt, Erdnüsse anzubauen und Details über den letzten
Kuhhandel.
Wieder op pad bewegen wir uns durch eine sanft hügelige Landschaft, die
weniger in die Knochen geht als die Berg und Tal Tour am Vormittag.
.jpg) Den
Abend und die Nacht verbringen wir bei Freunden von Mr. Charles in
Lamaing. Nach dem Abendessen bei Kerzenlicht in Homestayatmosphäre führen wir mit dem
Hausherrn ein durchaus angenehmes Streitgespräch über Gott und die
Welt. Einigen können wir uns auf den Minimalkonsens „Everybody wants to
be happy!“ Einigkeit herrscht bei der Einschätzung der politischen Lage
und dessen, was "eigentlich geschehen müsste". Mehr darüber in
Berlin … Den
Abend und die Nacht verbringen wir bei Freunden von Mr. Charles in
Lamaing. Nach dem Abendessen bei Kerzenlicht in Homestayatmosphäre führen wir mit dem
Hausherrn ein durchaus angenehmes Streitgespräch über Gott und die
Welt. Einigen können wir uns auf den Minimalkonsens „Everybody wants to
be happy!“ Einigkeit herrscht bei der Einschätzung der politischen Lage
und dessen, was "eigentlich geschehen müsste". Mehr darüber in
Berlin …
(Fotos vom
ersten Tag der
Wanderung)
(unsere Wanderung auf
Google
Earth)
Den
folgenden Tag wandern wir durch eine Landschaft, die, würde man die
Pinien, Banyons etc. gegen Zypressen tauschen und statt der Pagoden
Landhäuser errichten, stark an die Toscana erinnerte – bis auf die
fruchtbare rote Erde.
Auch in dieser Gegend scheint Mr. Charles jeden zu kennen: Kein
Gartenzaun, an dem nicht geplauscht würde, keine Gruppe, zu der er sich
nicht gesellte und der er uns nicht vorstellte. Wir erleben mal wieder
hautnah den Unterschied zwischen einem Guide und einem, der anderen nur den
Weg zeigt …
Eine alte Dame in einem Dorf der
Pa O beglückt er
mit dem Überreichen von Fotos,.jpg) die er, unsere Kamera in der Hand und das Geräusch des Auslösers
imitierend, aus der Brusttasche zaubert. Die Lady freut sich riesig über
ihr Konterfei, geht auf das Spielchen ein und möchte sogleich die
Bilder, die ich von ihr aufnehme …
die er, unsere Kamera in der Hand und das Geräusch des Auslösers
imitierend, aus der Brusttasche zaubert. Die Lady freut sich riesig über
ihr Konterfei, geht auf das Spielchen ein und möchte sogleich die
Bilder, die ich von ihr aufnehme …
Nach einer Runde durchs Dorf legen
wir im nächsten unsere Mittagsrast ein.
Am
späten Nachmittag erreichen wir das Kloster Hti Tain, wo uns der Abt
fast schon zeremoniell begrüßt. Unser Abendessen – der Koch hat schon
wieder gezaubert - nehmen wir im Refektorium der Novizen ein.
Geschlafen wird, jugendherbergsmäßig bescheiden, in der Versammlungs-
und Gebetshalle, in der durch Bambusmatten „Schlafzellen“ parzelliert
sind. Die Kraft der Gebete, mit denen uns der „Chief Monk“ eine ruhige
Nacht bescheren wollte, reicht bis zu den Vorbereitungen der
Meditationsgesänge gegen 4.30 Uhr.
„You won’t need an alarm clock!“ hat uns Mr. Charles gebrieft …
(der
zweite Wandertag im Bild)
Entsprechend früh sind wir auch wandermäßig auf
den Beinen. Leider führt der Weg vom Kloster zum
Inlesee über weite
Strecken auf einer staubigen Schotterpiste durch eine ausgetrocknete
Landschaft, die keinen Augenschmaus bietet.
.jpg) Erst
in Indain am Kanal wird’s wieder lieblicher. Das zieht natürlich jede
Menge ausflügelnder Touristen an. Die Bootsfahrt, zunächst durch Kanäle,
dann über den See, schließlich wieder durch einen breiten Kanal nach
Nyaung Shwe
entschädigt für die etwas öde Strecke am Vormittag. Erst
in Indain am Kanal wird’s wieder lieblicher. Das zieht natürlich jede
Menge ausflügelnder Touristen an. Die Bootsfahrt, zunächst durch Kanäle,
dann über den See, schließlich wieder durch einen breiten Kanal nach
Nyaung Shwe
entschädigt für die etwas öde Strecke am Vormittag.
Nachdem uns Mr. Charles wohl behalten und gut untergekommen in unserem
Guesthouse weiß und wir unser gemeinsam Erlebtes haben Revue passieren
lassen, macht er sich auf die Rückfahrt nach Kalaw. Der Abschied nach drei Tagen recht
intensiver Gespräche - weniger über Gott als über die Welt - hat
schon etwas Rührendes. Die Chemie zwischen uns stimmte eben …
(zum
dritten Tag)
(wiki zum
Inlesee)
Hier steppt der Bär …
nicht wirklich, doch sprüht das alte
Fürstenstädtchen
Nyaung Shwe
auch außerhalb des Fünftagemarktes vor Leben. Es ist was los, auch
wenn nichts los ist, und das liegt nicht an den zahlreichen Travellern, die, den Inlesee heimsuchend, hier wohnen.
Der Ort ist (noch)
nicht vom Tourismus.jpg) deformiert. Auch wenn jede Menge „Guesthouses“ und „Inns“ gerade in
diesem Jahr so ziemlich alle Betten mehr als los werden, die
Einheimischen dominieren noch immer die zahlreichen kleinen Teehäuser,
Restaurants und Straßenstände - als Gäste ...
deformiert. Auch wenn jede Menge „Guesthouses“ und „Inns“ gerade in
diesem Jahr so ziemlich alle Betten mehr als los werden, die
Einheimischen dominieren noch immer die zahlreichen kleinen Teehäuser,
Restaurants und Straßenstände - als Gäste ...
Und
von außerhalb kommen Angehörige der Hill Tribes und bringen mit ihren
Trachten jede Menge Farbe in die Sträßchen. Die bunte Mischung macht’s,
welche tagtäglich ihre landwirtschaftlichen Produkte in der Stadt an die
Frau bringt und sich selbst mit dem für sie Notwendigen eindeckt.
Der recht quirlige Ort, in dem Hektik allerdings
noch ein Fremdwort ist, lebt von und mit seiner Lage an DER
Wasserstraße dieser Region. Der
Inlesee
ist nicht nur die A1, sondern auch Nahrungsquelle
und Klimawächter. An den Anlegestellen und Löschplätzen steht von früh
bis spät kein Muskel still – und der Austausch eines Stützpfeilers der
einzigen Brücke über den Hauptkanal führt zu erheblichen Verkehrsstaus –
und zum „cinema for free“. Wir fühlen uns in diesem Ort so wohl, dass
wir hier glatt unseren Urlaub verbringen könnten.
(cinema
for free)
(einige
Gesichter)
(DER
SPIEGEL zum Inlesee)
(weitere
Infos zum Inlesee)
.jpg) Auch
in den Nebenstraßen und an den Nebenkanälen ist keineswegs Trauer
angesagt. Unglaublich viele Waren werden per Boot herbei geschafft und
von Trishaws, push carts oder auf dem Kopf den Empfängern zugestellt. Auch
in den Nebenstraßen und an den Nebenkanälen ist keineswegs Trauer
angesagt. Unglaublich viele Waren werden per Boot herbei geschafft und
von Trishaws, push carts oder auf dem Kopf den Empfängern zugestellt.
Was
Wunder, wenn ein solches Städtchen, das alles andere als arm sein
dürfte, zahlreiche Klöster beherbergt – der Teufel scheißt schließlich
immer auf denselben Haufen …
Einer dieser Haufen liegt eine knappe viertel Radstunde außerhalb: In
einem.jpg) Kloster aus Teakholz, Shwe Yan Pya, lernen und albern junge Mönchlein
vor sich hin, finden Gefallen an ihren unbuddhistischen Blödeleien wie
an umher schweifenden „foreigners“ und genießen ihre Pausen wie
dereinst unsere neuköllner Klientel …
Kloster aus Teakholz, Shwe Yan Pya, lernen und albern junge Mönchlein
vor sich hin, finden Gefallen an ihren unbuddhistischen Blödeleien wie
an umher schweifenden „foreigners“ und genießen ihre Pausen wie
dereinst unsere neuköllner Klientel …
(Fotos
aus dem Kloster)
Zumindest die Novizen im Htut Aing Kloster sind noch nicht auf Fremde
genordet und posen ganz unbefangen. Ihr älterer Kollege greift gleich
zur Taschenlampe,
.jpg) führt
uns in die Meditations- und Gebetshöhlen im Karstgestein und trägt die „donation
for Buddha“ unverfroren in welchen Laden nebenan auch immer. führt
uns in die Meditations- und Gebetshöhlen im Karstgestein und trägt die „donation
for Buddha“ unverfroren in welchen Laden nebenan auch immer.
(caves &
wines)
Dank ortskundiger Helfer finden wir zum
Weingut auf gut 1.000 m Höhe. Die Lese des
Sauvignon Blanc hat vor zwei Tagen begonnen - Ende Februar! Warum auch
immer lassen wir uns nicht verführen - und trinken in unserer Stadt in
unserer Kneipe ein Gezapftes …
Keineswegs für Deppen …
ist
die Bootstour über den Inlesee, auch wenn sie auf den ersten Blick wie
eine.jpg) Verkaufsfahrt für Rentner aufgezogen wirkt. Unser Skipper steuert
zunächst den Fünftagemarkt in
Phaung Daw Oo an, auf dem es neben den
Früchten des Feldes auch jede Menge unterschiedlichen Fischs in allen
essbaren Zuständen zu erhandeln gibt. Da sich kaum ein „foreigner“ über
die ersten beiden Reihen Stände hinaus wagt, sind wir zwei wunderbar
alleine unter all den Locals.
Verkaufsfahrt für Rentner aufgezogen wirkt. Unser Skipper steuert
zunächst den Fünftagemarkt in
Phaung Daw Oo an, auf dem es neben den
Früchten des Feldes auch jede Menge unterschiedlichen Fischs in allen
essbaren Zuständen zu erhandeln gibt. Da sich kaum ein „foreigner“ über
die ersten beiden Reihen Stände hinaus wagt, sind wir zwei wunderbar
alleine unter all den Locals.
(zum
Fünftagemarkt in Phaung Daw
Oo)
Natürlich werden Produktionsstätten des örtlichen
Handwerks angelaufen. Bis auf die Silberschmiede produzieren die auf dem
goldenen Boden mit Mitteln und Werkzeugen aus dem vorletzten
Jahrhundert. Niemand aus der jeweiligen Verkaufsabteilung drängt jedoch
zum Erwerb ihrer Waren, so dass wir diese Runde Heimatmuseum in aller
Ruhe genießen.
Die
Beete der „Floating Gardens“ erleben wir in den verschiedensten
Vegetationsphasen, von unbestellt über gerade umgegraben bis reichlich
Tomaten,
.jpg) Erbsen,
Bohnen, Gemüse tragend. Gegärtnert wird vom Nachen aus, das Bewässern
erledigt sich von selbst. Der kommende Fünftagemarkt bringt die Erträge
ins Städtchen – per Boot. Erbsen,
Bohnen, Gemüse tragend. Gegärtnert wird vom Nachen aus, das Bewässern
erledigt sich von selbst. Der kommende Fünftagemarkt bringt die Erträge
ins Städtchen – per Boot.
Im
in allen Reiseführern hinreichend beschriebenen Kloster der "jumping
cats" herrscht Mittagsruhe. Jedenfalls liegen die Vierbeiner träge in
der Versammlungshalle und lassen sich kaum zum Sprung durch den Reifen
bewegen – "Sleeping Cats Monastery". Wir können die Bartputzer nur zu
gut verstehen, verfallen wir nach unserer Rückkehr ins Guesthouse doch
in einen ähnlichen Zustand ...
(von
Handwerkern und Katzen)
(und vom
ruhigen Treiben auf den Seitenkanälen)
(Fremdvideo zu "Floating
Gardens")
Der weiteste Weg
lohnt
…
nicht zu Möbel Tegeler, sondern ins alte Pagodenfeld von Kakku. Die
recht.jpg) lange Fahrt führt bereits kurz vor
Taunggyi
durch eine spannende Hügellandschaft und später durch mehrere Pa O
Dörfer. Eines wartet mit einer weiteren Version des Fünftagemarktes auf:
Viehmarkt. Den bestreiten ausnahmslos Männer.
lange Fahrt führt bereits kurz vor
Taunggyi
durch eine spannende Hügellandschaft und später durch mehrere Pa O
Dörfer. Eines wartet mit einer weiteren Version des Fünftagemarktes auf:
Viehmarkt. Den bestreiten ausnahmslos Männer.
In der Hauptstadt des Shan States erhalten wir problemslos unser permit
und eine ausgesprochen reizende Begleiterin, die uns als "language
conductur" mit reichlich Ahnung durch die Altertümer führen soll.
Auf einem knappen Quadratkilometer stehen
gut
zweieinhalbtausend Tempelchen,
.jpg) Stupas
und Gräber dicht an dicht und verwirren das Auge im flirrenden
Licht. Einige Stupas sind unverputzt geblieben, so dass der
Ziegelkörper deutlich zu erkennen ist. Andere sind über und über mit
Glück bringenden oder Böses abwendenden Skulpturen und Reliefs verziert.
Die Geschichte der Anlage liegt im Dunkeln - und mit ihr das genaue
Alter. Ist auch egal, ist der Anblick doch schlichtweg sehr
beeindruckend ... Stupas
und Gräber dicht an dicht und verwirren das Auge im flirrenden
Licht. Einige Stupas sind unverputzt geblieben, so dass der
Ziegelkörper deutlich zu erkennen ist. Andere sind über und über mit
Glück bringenden oder Böses abwendenden Skulpturen und Reliefs verziert.
Die Geschichte der Anlage liegt im Dunkeln - und mit ihr das genaue
Alter. Ist auch egal, ist der Anblick doch schlichtweg sehr
beeindruckend ...
(Fotos vom
Pagodenfeld in Kakku)
(unsere Ausflüge auf
Google Earth)
Der Abschied vom Inlesee
…
fällt insofern nicht ganz leicht als sich sein Zugang von Land aus recht
schwierig gestaltet. Wege, die vermeintlich an seine Ufer führen, enden
an Pagoden im Bambus, einem Gehöft oder im Sumpf. Wenn man den
richtigen Riecher hat, leiten sie einen zu einem Resort, das den Zugang
zur "Aussichtsterrasse" nicht verweigert.
Unsere Suche führt uns per Rad über den
Fünftagemarkt in Maing Tauk, wo.jpg) endlich mal Männer hinterm Warensortiment stehen, bevor wir uns über
die U Bein Brücke light dem Stelzendorf nähern, welches wir per
Einbeinruderer erkunden. In seinem Nachen können wir uns davon
überzeugen, dass die schmalen Beete gut bestellt sind - und als Packung
aus "weed" und Erdreich tatsächlich auf dem Wasser schwimmen, mit
langen Bambusstangen am Grund verankert. Wohlschmeckend sind die
Tomaten, Zwiebeln und Knoblauchzehen, die dort gedeihen, wie uns der
Salat im kleinen Restaurant überm Wasser zeigt. Den See selbst sehen wir
nicht, wir hören ihn. Er liegt dort, wo die Motorboote knattern ...
endlich mal Männer hinterm Warensortiment stehen, bevor wir uns über
die U Bein Brücke light dem Stelzendorf nähern, welches wir per
Einbeinruderer erkunden. In seinem Nachen können wir uns davon
überzeugen, dass die schmalen Beete gut bestellt sind - und als Packung
aus "weed" und Erdreich tatsächlich auf dem Wasser schwimmen, mit
langen Bambusstangen am Grund verankert. Wohlschmeckend sind die
Tomaten, Zwiebeln und Knoblauchzehen, die dort gedeihen, wie uns der
Salat im kleinen Restaurant überm Wasser zeigt. Den See selbst sehen wir
nicht, wir hören ihn. Er liegt dort, wo die Motorboote knattern ...
(Fotos aus
Maing Tauk)
Knapp dreizehn Wochen…
nach unserem ersten Besuch vertiefen sich selbst
jetzt, zum Vollmond im
Tabaung,
dem Höhepunkt des höchsten und
wichtigsten Festes der Shwedagon Pagode,
unsere Eindrücke: Trotz Zehntausender Gläubiger, die das Plateau
.jpg) brechend
voll erscheinen lassen, herrscht zwar Gewusel, doch keine spürbare Unruhe,
mitunter zügiges Schreiten, doch keinerlei Eile – es bleibt bei der
feierlichen, erhabenen Atmosphäre. Und es wird einmal mehr deutlich,
dass sich hier profanes nicht so einfach vom sakralen Leben trennen
lässt: In Tempeln, Gebets- und Versammlungshallen ebenso wie unter
freiem Himmel verharren Menschen in Andacht, in Meditation oder im
Gebet während andere lagern, picknicken, ruhen, schlafen, miteinander
reden oder einfach nur dem Film zuschauen, der soeben an ihnen
vorbeiläuft. brechend
voll erscheinen lassen, herrscht zwar Gewusel, doch keine spürbare Unruhe,
mitunter zügiges Schreiten, doch keinerlei Eile – es bleibt bei der
feierlichen, erhabenen Atmosphäre. Und es wird einmal mehr deutlich,
dass sich hier profanes nicht so einfach vom sakralen Leben trennen
lässt: In Tempeln, Gebets- und Versammlungshallen ebenso wie unter
freiem Himmel verharren Menschen in Andacht, in Meditation oder im
Gebet während andere lagern, picknicken, ruhen, schlafen, miteinander
reden oder einfach nur dem Film zuschauen, der soeben an ihnen
vorbeiläuft.
Und
dieser Film ist, vor anderer Kulisse, eine Retro dessen, was wir während
der vergangenen drei Monate immer wieder erlebt haben: friedfertige,
unaufgeregt wirkende Menschen, die uns warmherzig, hilfsbereit,
freundlich und offen begegneten. Ja, ja, wir weilen
nicht im Paradies,
wir haben durchaus hinter einige Kulissen schauen können …
Die Menschen, ihre Art, darin sind wir uns einig,
sind das Faszinierende an und.jpg) in diesem Land. Spektakuläre Landschaften wie in Südamerika (oder
selbst im alpinen Bereich der Schweiz) sind uns in den Gegenden, die
wir hier bereist haben, nicht untergekommen, recht reizvolle schon. Und
- nein, weder lassen wir unser Auto verschrotten noch treten wir aus der
Krankenkasse aus – mit welch einfachen Mitteln Leben gestaltet (oder
auch improvisiert) werden kann, gibt eine Menge zu denken; könnte ja
helfen, den nächsten Kratzer am gewohnten Lebensstandard nicht gleich
als Totalschaden einzustufen.
in diesem Land. Spektakuläre Landschaften wie in Südamerika (oder
selbst im alpinen Bereich der Schweiz) sind uns in den Gegenden, die
wir hier bereist haben, nicht untergekommen, recht reizvolle schon. Und
- nein, weder lassen wir unser Auto verschrotten noch treten wir aus der
Krankenkasse aus – mit welch einfachen Mitteln Leben gestaltet (oder
auch improvisiert) werden kann, gibt eine Menge zu denken; könnte ja
helfen, den nächsten Kratzer am gewohnten Lebensstandard nicht gleich
als Totalschaden einzustufen.
Einmal mehr ist uns bewusst, was für ein verdammtes Glück wir hatten, zu
dem Zeitpunkt an eben jenem Ort auf der Erde das Licht der Welt zu
erblicken, an dem wir damals geboren worden sind - und dort leben zu
können wo wir leben.
Genießen wir’s, gerade weil wir nichts dafür können …
Bis demnächst
panther & co
Glossar:
|
Aung San Sun Kyi |
|
Ayeyarwady-Delta |
|
Bagan |
|
Bagan, Ballonfahrt |
|
Bilu Kyun |
|
Busbahnhof |
|
Chin Dörfer |
|
circle train |
|
Fünftagemarkt, Pindaya |
|
Geld tauschen |
|
Gokteik Viadukt |
|
Golden Rock |
|
Gummibänder |
|
Hpa An |
|
Hpo Win Taung |
|
Hsipaw |
|
Inlesee |
|
Inlesee, Bootstour |
|
Inlesee, Floating Gardens |
|
Inlesee, Trekking |
|
Inwa |
|
Kakku |
|
Kalaw |
|
Kawt Gon |
|
Kayin State |
|
Kinpun |
|
Kyaikmayaw |
|
Kyiaiktyo Pagode |
|
Leben am Fluss, Mandalay |
|
Mahagandhayon Kloster, Amarapura |
|
Mahamuni Buddha, Mandalay |
|
Mandalay |
|
Mawlamyaing |
|
Minnanthu |
|
Mon People |
|
Monywa |
|
Moulmein |
|
Mr. Charles |
|
Mrauk U / Mrauk Oo |
|
Nyaung Shwe |
|
Pa O People |
|
Palaung People |
|
Pathein |
|
pathein hti |
|
Pindaya |
|
Pyin Oo Lwin |
|
Reeperbahn |
|
Ringbahn, Yangon
|
|
Shwe Yan Pya |
|
Shwedagon Pagode |
|
Sittwe |
|
Tattoo Ladies |
|
The Lady |
|
Trekking zum Inle See |
|
U Bein Brücke |
|
umbrella |
|
Visa on Arrival |
|
Yangon |
|
Yangon, dowtown
|
|
Zugfahrt nach Hsipaw |
|
|
r
Seitenanfang
|
 panther
& co unterwegs ...
panther
& co unterwegs ...